Was ist Wahrheit? (Alan Woods)
„Was ist Wahrheit?“ fragte Pilatus spöttisch, und wartete die Antwort nicht ab.
So beginnt Francis Bacons Essay Von der Wahrheit. Bacon bezog sich auf das Johannesevangelium, in dem Jesus, als er von dem römischen Statthalter Pilatus befragt wurde, sagt: „Ich bin dazu geboren und dazu in die Welt gekommen, dass ich für die Wahrheit Zeugnis ablege.“
Darauf antwortete Pilatus mit einer gehörigen Menge Ironie: „Was ist Wahrheit?“ Mit diesen wenigen Worten zeigte er nicht, dass er ein Zyniker im modernen Sinne des Worts war (auch wenn er das höchstwahrscheinlich war), sondern ein gebildeter Mann und ein Anhänger eines Standpunkts, welcher unter der kultivierten und des Lebens überdrüssigen römischen Oberschicht zu jener Zeit weit verbreitet war.
Pilatus wartete nicht auf eine Antwort, aus dem einfachen Grund, dass er nicht glaubte, dass es zu dieser Frage eine Antwort gab. Eine verbreitete philosophische Strömung jener Zeit – welche das Produkt einer zerfallenden Gesellschaft war – behauptete, dass es unmöglich sei, zu einer objektiven Auffassung der Wahrheit zu gelangen.
Diese Art von extremem Subjektivismus (Subjektiver Idealismus) ist nicht neu. In der Philosophie tritt dieser Trend regelmäßig in Erscheinung, als eine Art nervöses Zucken, oder besser gesagt als ein Krampfanfall, ausgelöst von der Verzweiflung, jemals auch nur in die Nähe der Erkenntnis einer objektiven Wahrheit zu kommen.
Das fand seinen vollständigsten und konsequentesten Ausdruck in den Schriften des berühmten griechischen Sophisten Gorgias von Leontinoi, welcher behauptete, dass (1) nichts existiert; (2) selbst, wenn es doch existieren würde, könnte man dessen Wesen nicht verstehen; und (3) selbst, wenn es verstanden werden könnte, könnte es einer anderen Person nicht vermittelt werden.
Sophisten wie Gorgias waren Vorläufer des philosophischen Standpunkts, der als Skeptizismus bekannt ist. Im Großen und Ganzen sind Hume und Kant nicht viel weiter darüber hinausgekommen. Es sind alles Variationen desselben Problems. Auf die Spitze getrieben wurde es von Bischof Berkeley, dessen Philosophie Lenin in einem seiner wichtigsten theoretischen Werke, Materialismus und Empiriokritizismus, ausführlich beantwortet.
Doch der wohl einflussreichste Vertreter einer Spielart des Skeptizismus war der brillante deutsche Philosoph des 18. Jahrhunderts, Immanuel Kant.
Kant
Kant war einer der originellsten und einflussreichsten Denker seiner Zeit. Er machte eine Reihe brillanter Entdeckungen, vor allem auf dem Gebiet der Kosmologie. Jedoch schaffte er es nie, aus der Fallgrube des philosophischen Dualismus zu entkommen, der besagt, dass die Welt der Gedanken und die materielle Welt unabhängig voneinander existieren.
Als er entdeckte, dass es unlösbare Widersprüche in der Erkenntnis der materiellen Welt gibt, zog er den Schluss, dass es ein absolutes Limit für unsere Erkenntnisfähigkeit geben muss.
Kant glaubte, dass es zwischen dem denkenden Subjekt und dem Objekt, das es zu erkennen gilt, einen unüberbrückbaren Abgrund gibt. Nach der kantischen Theorie sind wir von der Realität abgeschnitten durch dieselben Werkzeuge, die wir vergeblich einsetzen, um sie zu verstehen.
Er behauptete daher, dass wir nur Wissen haben können über Phänomene (Erscheinungen) – Dinge, wie sie dem Beobachter erscheinen. Das menschliche Wissen war somit auf die unmittelbare Erkenntnis der Sinneswahrnehmungen beschränkt, jenseits derer das geheimnisvolle „Ding an sich“ liegt, das er für unerkennbar erklärte.
Skeptizismus heute
Seit Kant ist der Skeptizismus immer wieder in verschiedenen Variationen aufgekommen. Jede Variation mag verschieden sein, aber der wesentliche Inhalt bleibt derselbe: Das menschliche Wissen ist begrenzt und es gibt bestimmte Dinge, die man niemals wissen wird können.
Einige Philosophen (die paradoxerweise vom Empirismus ausgehen) nehmen an, dass die Welt gar nicht existiert. Andere versuchen dieses Problem gar zu umgehen, indem sie behaupten, dass der Konflikt zwischen Idealismus und Materialismus kein Thema ist und nur das Resultat eines falschen Sprachgebrauchs oder eines Missverständnisses.
Die gleiche skeptische Herangehensweise kann in der heutigen akademischen Welt beobachtet werden, wo die gleichen alten, verfaulten und diskreditierten Ideen in jüngster Zeit aus dem Müllhaufen der Geschichte gerettet und unter dem Deckmantel des sogenannten Postmodernismus wiederbelebt wurden.
Hier versteckt sich hinter dem dünnen Schleier der Scheinobjektivität der grundlegende Narzissmus des kleinbürgerlichen Intellektuellen, der in seiner vollen Pracht hervortritt. Willig, diesem bereits ausgetretenen Pfad zu folgen, ist die moderne bürgerliche Philosophie in eine Sackgasse geraten.
Anstelle der Wahrheit gibt es nur noch meine Wahrheit, meine persönliche Meinung, weil das alles ist, nach dem ich jemals zu wissen bestrebt sein kann.
Die Suche nach einer wirklichen objektiven Wahrheit kommt hier zu einem völligen Stillstand, denn meine Wahrheit ist genauso gut wie deine Wahrheit. Nach dieser Theorie ist meine Wahrheit sogar unendlich viel besser, da nur ich existiere.
Eine irrationale Philosophie
Wir sollten uns darüber im Klaren sein, wenn man diese Sichtweise akzeptiert, würde das nicht nur das Ende aller Philosophie, sondern des rationalen Denkens im Allgemeinen bedeuten. Es würde alles Denken auf reine Subjektivität und absolute Relativität reduzieren, in der meine Wahrheit genauso gut ist wie deine „Wahrheit“, denn jede Wahrheit ist bloß eine subjektive Meinung.
Anstelle von Wissen hätten wir nur Meinung. An den Platz der Wissenschaft tritt der Glaube.
Als konsequente Materialisten lehnen Marxisten diese Sichtweise ab. Der philosophische Materialismus nimmt die Materie als ursprünglich an und nicht die Ideen. Er erklärt, dass Ideen, Gedanken usw. nur die Eigenschaften der Materie sind, die in einer bestimmten Weise organisiert ist.
Machen wir uns also die Mühe, die von Pontius Pilatus gestellte Frage zu beantworten. Unter Wahrheit verstehen wir menschliches Wissen, welches die objektive Welt, ihre Gesetze und Eigenschaften korrekt wiedergibt.
Die gesamte Wissenschaft basiert genau auf der Tatsache, dass:
a) die Welt außerhalb von uns selbst existiert, und
b) wir sie im Allgemeinen verstehen können.
Der Beweis für diese Behauptungen, wenn ein Beweis dafür notwendig wäre, besteht aus mehr als 2000 Jahren des Fortschritts in der Wissenschaft, d. h. des stetigen Fortschritts des Wissens gegenüber der Ignoranz.
Es versteht sich von selbst, dass es zu jedem Zeitpunkt natürlich viele Dinge geben wird, die wir nicht wissen. Und weil die Natur ein Vakuum verabscheut, können diese Lücken in unserem Wissen leicht mit allerlei religiösem und mystischem Unsinn gefüllt werden. Die sogenannte „Unbestimmtheitsrelation“, mit dem sich Ben Curry in seinem Artikel über Idealismus in der Quantenphysik befasst, ist ein Paradebeispiel für diesen Mystizismus in der Welt der Wissenschaft. Es ist das Äquivalent zu den alten Weltkarten, wo die unerforschten Regionen mit den Worten „Hier sind Drachen“ markiert sind.
Es besteht jedoch ein gewaltiger Unterschied zwischen den Aussagen „Wir wissen es nicht“ und „Wir können es nicht wissen“. Es gibt immer viele Dinge, die wir nicht wissen. Aber was wir heute nicht wissen, werden wir mit Sicherheit morgen wissen. Der Prozess, die Welt zu verstehen, schreitet gerade dadurch voran, dass wir in die Geheimnisse der Natur eindringen und unser Wissen über die materielle Welt ständig erweitern und vertiefen.
Von der Ignoranz zum Wissen
Die Suche nach der Wahrheit ist ein niemals endender Prozess, der immer tiefer in die Natur eintaucht. Der Fortschritt der Wissenschaft ist ein ständiger Ablauf von Bestätigung und Negation, bei dem eine Idee eine andere negiert und aufhebt und ihrerseits negiert und aufgehoben wird, wie Adam Booth in seinem Artikel über die Krise in der heutigen Wissenschaft erklärt. Dieser Prozess hat keine Grenzen; er kennt keine unüberwindbaren Hindernisse, und jedes Mal, wenn er auf eines trifft, wird es schließlich überwunden und negiert.
Der Widerspruch zwischen bewusstem „Subjekt“ und äußerem „Objekt“ wird deshalb durch den Prozess der Erkenntnis, des immer tieferen Eindringens in die objektive Welt, überwunden – nicht nur mittels des Denkens, sondern vor allem durch die Anwendung menschlicher Arbeit, durch welche der Mensch die Welt und damit auch sich selbst verändert hat.
Die gesamte Geschichte der Wissenschaft ist nichts anderes als ein ständiger Kampf um die Wahrheit, der Übergang vom Unwissen zum Wissen. Diese unaufhörliche Suche nach der Wahrheit ist vom Aufstieg und Niedergang verschiedener Theorien gekennzeichnet, von denen jede der vorhergegangenen widerspricht, aber gleichzeitig ihren wesentlichen Inhalt beibehält.
In einem bemerkenswerten Buch mit dem Titel Die Struktur wissenschaftlicher Revolutionen (erstmals 1962 veröffentlicht) definiert Thomas Kuhn ein wissenschaftliches Paradigma als „allgemein anerkannte wissenschaftliche Leistungen, die für eine gewisse Zeit einer Gemeinschaft von Fachleuten maßgebende Probleme und Lösungen liefern“.
Eine Zeit lang wird das bestehende Paradigma als absolut gültig und richtig angesehen. Diese langen Perioden der Kontinuität und des zunehmenden Fortschritts stellen Perioden der „normalen Wissenschaft“ dar. Das bestehende Paradigma wird allgemein akzeptiert, und dies ermöglicht der Wissenschaft, innerhalb eines allgemein akzeptierten theoretischen Rahmens in geordneter Weise voranzukommen.
Alle Theorien müssen jedoch ständig durch Beobachtungen und Experimente überprüft werden. Im Laufe der Zeit werden bestimmte Abweichungen auftauchen, welche scheinbar jedoch keine ernsthafte Herausforderung für die existierenden Paradigmen darstellen. Ab einem bestimmten Zeitpunkt wird jedoch aus der Quantität eine Qualität. Die Widersprüche häufen sich und führen schließlich zum Zusammenbruch des alten Paradigmas, das durch ein neues und überlegeneres Paradigma ersetzt werden muss. Der Status quo wird plötzlich durch Perioden „wissenschaftlicher Revolutionen“ unterbrochen.
Ein spektakuläres Beispiel für eine Kuhnsche Krise und eine wissenschaftliche Revolution spielt sich zurzeit vor unseren Augen ab – oder besser gesagt, hinter verschlossenen Türen – auf dem Gebiet der Kosmologie. Seit Jahrzehnten beruht das wissenschaftliche Verständnis und die Erforschung des Universums auf dem sogenannten „Standardmodell“. Dazu gehört die Behauptung, dass alles an Materie, Zeit und Raum in einer „Urknall“-Singularität entstanden ist, die schätzungsweise vor etwa 14 Milliarden Jahren stattgefunden haben soll.
Jüngste Beobachtungen weit entfernter Galaxien durch das James-Webb-Weltraumteleskop haben jedoch ernsthafte Zweifel an dieser allgemein akzeptierten Theorie aufkommen lassen. Im Rahmen des Urknallmodells ist es unmöglich, dass diese weit entfernten Galaxien so groß und entwickelt sein können, wie sie sind. Mit anderen Worten: Die neuesten Beweise stehen in gewaltigem Widerspruch zum derzeitigen Paradigma.
Wie von Kuhn vorhergesagt, hat dies eine Krise in der wissenschaftlichen Community ausgelöst. Ein Teil steckt den Kopf in den Sand und versucht weiter, die Fakten so zu beugen, damit sie zu ihrer maroden Theorie passen. Ein anderer Teil ist verzweifelt und beginnt, das gesamte Modell infrage zu stellen, an welches viele Karrieren und viel Ansehen gekoppelt sind.
Noch finden diese Debatten weitestgehend im Verborgenen statt, innerhalb des wissenschaftlichen Establishments und fernab von neugierigen Blicken. Doch irgendwann wird die Krise der Kosmologie an die Öffentlichkeit dringen und den Weg für einen Paradigmenwechsel – eine Revolution – auf dem Gebiet der Grundlagenphysik bereiten.
Relativ oder absolut?
Für eine gewisse Zeit akzeptieren wir das existierende Paradigma als absolute Wahrheit. Erst in letzter Instanz, als diese absolute Wahrheit ihre unvollständige und widersprüchliche Natur offenbart, wird ihr grundlegend relativer und vorübergehender Charakter deutlich. Sind wir aber berechtigt, aus dieser Tatsache die Schlussfolgerung zu ziehen, dass es so etwas wie Wahrheit nicht gibt und dass es daher, wie Pontius Pilatus meinte, sinnlos ist, überhaupt zu versuchen, sie zu definieren?
Nein. Wir sind nicht berechtigt, solche Schlüsse zu ziehen. Die Wahrheit ist nichts Absolutes, das für alle Zeit gegeben und festgelegt ist. Sie ist ein Prozess, der sich in einem niemals endenden Kreislauf ständiger Widersprüche, Bestätigungen und Negationen bewegt. Die Geschichte von Wissenschaft und Technik und der ganze Verlauf der menschlichen sozialen Entwicklung haben dazu gedient, Wissen zu definieren, zu vertiefen und zu verifizieren.
In diesem Sinne (und nur in diesem Sinne) kann man sagen, dass die Wahrheit relativ ist. Sie ist ein sich ständig weiterentwickelnder Prozess, der niemals zum Stillstand kommt, sondern ständig darauf drängt, tiefer in die Geheimnisse des Universums einzudringen. Dieses Thema hat Goethe in seinem monumentalen Meisterwerk Faust aufgegriffen, mit dem sich Josh Holroyd in dieser Ausgabe beschäftigt.
Das ist der Grund, warum wir die Wahrheit nicht in ein Dogma verwandeln dürfen, da wir niemals zu einer unveränderlichen absoluten Erkenntnis gelangen werden, weil das Universum selbst unendlich ist und sich konstant verändert, ohne Anfang und ohne Ende.
Die Wahrheit liegt nicht in einem imaginären Endergebnis, in dem alle unsere Zweifel und Herausforderungen aufgelöst sind, sondern in dem unendlichen Prozess der Entdeckung selbst, der allein es uns erlaubt, Schritt für Schritt die Geheimnisse des wunderbaren, komplexen und unendlich schönen materiellen Universums nach und nach zu enthüllen.
Hegel schrieb in der Wissenschaft der Logik: „Es ist die Natur des Endlichen selbst, über sich hinauszugehen, seine Negation zu negieren und unendlich zu werden.“
Das ist eine sehr tiefgründige Wahrheit. Das Streben der Menschheit nach Wissen wird immer auf Hindernisse stoßen, die auf den ersten Blick unüberwindbar erscheinen. Aber die Hindernisse werden schließlich überwunden, nur um neue Hindernisse und Herausforderungen zu schaffen, die wiederum überwunden werden müssen.
Wenn wir nach einer absoluten Wahrheit suchen, die uns endlich erlaubt zu sagen: „Wir verstehen jetzt alles und es gibt nichts mehr zu entdecken“, dann wird dieser Tag nie kommen.
Das Universum ist unendlich, doch die Fähigkeit der menschlichen Erkenntnis ist ebenso unendlich wie das Universum selbst. Und das einzig Absolute ist die Veränderung.
Letztendlich ist es dieser endlose Prozess der Vertiefung aller Erkenntnis über das Universum, der allein die Wahrheit ausmacht.
Was bedeutet das für den Marxismus?
Welche Schlussfolgerungen können wir daraus in Bezug auf den Marxismus selbst ziehen? Können wir sagen, dass die Ideen von Marx und Engels für alle Zeiten gültig bleiben? Dies würde im Widerspruch zum dialektischen Wesen des Marxismus selbst stehen.
Es wäre eine sinnlose Übung, zu versuchen, all die vielen komplexen Veränderungen im menschlichen Denken vorherzusehen, die in der Zukunft unvermeidlich auftreten werden. Ich habe nicht den Wunsch, mich auf solche leeren Spekulationen einzulassen. Jedoch können wir sicher sein, dass irgendwann in der Zukunft neue Ideen aufkommen, welche die alten verdrängen werden – auch wenn es sich, wie Hegel erklärte, oft um einen Prozess handelt, bei dem unnötige Ideen verworfen werden, während alles Wertvolle, Nützliche und Notwendige aus der Vergangenheit bewahrt wird.
Diese Feststellungen müssen sich auf den Marxismus beziehen, wie auf alles andere auch. Zum derzeitigen Zeitpunkt haben die Ideen des Marxismus jedoch zweifellos das Recht erlangt, als unerlässliche Anleitung zum Handeln ernst genommen zu werden. Das Gleiche kann man nicht über die erbärmlichen Ideen der Bourgeoisie sagen, die sich auf einem Gebiet nach dem anderen als falsch erwiesen haben.
Es genügt, auf die Tatsache hinzuweisen, dass immer mehr bürgerliche Ökonomen Das Kapital studieren, um die aktuelle Krise des Kapitalismus zu verstehen, die kein einziger von ihnen vorhersagen oder erklären konnte.
Während meines gesamten Erwachsenenlebens habe ich es mir zur Aufgabe gemacht, den Marxismus zu studieren. Ich habe mir auch die Mühe gemacht, die Werke der Kritiker des Marxismus zu lesen und eine Reihe von alternativen Theorien in Erwägung gezogen. Aber keine dieser Theorien kann man mit der Brillanz und Tiefgründigkeit des gigantischen Gesamtwerks von Marx, Engels, Lenin und Trotzki vergleichen.
Nur diese Ideen haben sich im Laufe der Zeit bewährt. Wir können es also ohne Bedenken der Zukunft überlassen, uns mit etwas Besserem zu bereichern. Bis dieser wunderbare Tag anbricht, werde ich mich weiterhin auf die soliden Grundlagen des wissenschaftlichen Sozialismus stützen, die ich, bis mich jemand vom Gegenteil überzeugen kann, als absolute Wahrheiten betrachten werde – zumindest für die Gegenwart. Das ist völlig ausreichend.
Krise in der Wissenschaft: Fortschritt, Stillstand und Revolution
- ‘An Existential Crisis’ for Science – What IPR scholars are doing to solve the replication crisis, 28. Februar 2024.
[https://www.ipr.northwestern.edu/news/2024/an-existential-crisis-for-science.html] - M. Park, E. Leahey, R. J. Funk: Papers and patents are becoming less disruptive over time, in Nature 613 (2023), S. 138-144.
[https://www.nature.com/articles/s41586-022-05543-x] - Ebd.
- Ebd.
- Ebd.
- N. Bloom, C. I. Jones, J. Van Rennen, M. Webb: Are Ideas Getting Harder to Find?, in American Economic Review 110/4 (2020), S. 1104-1144.
[https://www.aeaweb.org/articles?id=10.1257/aer.20180338] - M. Baker: 1500 scientists lift the lid on reproducibility, in Nature 533 (2016), S. 452.
[https://www.nature.com/articles/533452a] - C. G. Begley, L. M. Ellis: Raise standards for preclinical cancer research, in Nature 483 (2012) S. 531; [https://www.nature.com/articles/483531a]
und F. Prinz, T. Schlange, K. Asadullah: Believe it or not: how much can we rely on published data on potential drug targets?, in Nature Reviews Drug Discovery 10 (2011), S. 712.
[https://www.nature.com/articles/nrd3439-c1] - R. Van Noorden: More than 10000 research papers were retracted in 2023 — a new record, in Nature 624 (2023), S. 479.
[https://www.nature.com/articles/d41586-023-03974-8] - R. McKie: ‘The situation has become appalling’: fake scientific papers push research credibility to crisis point, in The Guardian, 3. Februar 2024.
[https://www.theguardian.com/science/2024/feb/03/the-situation-has-become-appalling-fake-scientific-papers-push-research-credibility-to-crisis-point] - Zit. in H. Devlin: James Webb telescope detects evidence of ancient ‘universe breaker’ galaxies, in The Guardian, 22. Februar 2023.
[https://www.theguardian.com/science/2023/feb/22/universe-breakers-james-webb-telescope-detects-six-ancient-galaxies] - A. Witze: Four revelations from the Webb telescope about distant galaxies, in Nature 608 (2022), S. 18-19.
[https://www.nature.com/articles/d41586-022-02056-5] - E. Lerner: The Big Bang Never Happened, Simon and Schuster, 1991, S. 4.
- J. D. Bernal: Science in History, Watts and Co., 1954, S. 13.
- F. Engels: Herrn Eugen Dührings Umwälzung der Wissenschaft (Anti-Dühring), in Marx Engels Werke (MEW), Bd. 20, S. 34.
- W. I. Lenin: Materialismus und Empiriokritizismus, in Lenin Werke (LW), Bd. 14, S. 129.
- Ebd., S. 132.
- F. Engels: Ludwig Feuerbach und der Ausgang der klassischen deutschen Philosophie, in MEW, Bd. 21, S. 267.
- F. Engels: Notizen und Fragmente – Dialektik, MEW, Bd. 20, S. 507.
- T. Kuhn: Die Struktur wissenschaftlicher Revolutionen, Suhrkamp, 1976, S. 38.
- Ebd., S. 66.
- Ebd., S. 65.
- Ebd., S. 104.
- Ebd., S. 106.
- J. D. Bernal: Science in History, S. 28.
- Ebd.
- Ebd.
- Ebd.
- F. Engels: Anti-Dühring, in MEW, Bd. 20, S. 20.
- J. D. Bernal: The Social Function of Science, Routledge and Sons, 1946, S. 27.
- M. Peel, E. Olcott: China-US tensions erode co-operation on science and tech, in Financial Times, 19. August 2024.
[https://www.ft.com/content/68ab4ed3-2f9a-4d0d-a23e-59db2555e1b0] - W. Tan: Is arXiv a monopoly bully in scientific publication?, in Perfectly Imperfect Mirrors, 15. Mai 2021.
[https://www.wanpengtan.com/2021/05/15/is-arxiv-a-monopoly-bully-in-scientific-publication/] - W. I. Lenin: Drei Quellen und drei Bestandteile des Marxismus, in LW, Bd. 19, S. 3.
- K. Marx, F. Engels: Die deutsche Ideologie, in MEW, Bd. 3, S. 46.
- W. I. Lenin: Über die Bedeutung des streitbaren Materialismus, in LW, Bd. 33, S. 214.
- K. Marx, F. Engels: Manifest der Kommunistischen Partei, in MEW, Bd. 4, S. 465.
Goethes Faust: Im Anfang war die Tat
Sämtliche Zitate aus dem Faust sind aus der Ausgabe von Reclam, 2000.
- J. W. von Goethe: Dichtung und Wahrheit. Hermann Seemann Nachfolger, 1903, S. 186.
- Zitiert nach R. Safranski: Goethe: Kunstwerk des Lebens, Carl Hanser Verlag, 2013, S. 155.
- H. Heine: Die Romantische Schule, Hoffmann und Campe, 1836, S. 61.
- Zitiert nach F. W. von Biedermann (Hg.): Goethes Gespräche, Bd. 8, Biedermann (Leipzig), 1909, S. 116.
- Zitiert nach C. Hamlin (Hg.): Faust, Norton, 2001, S. 515.
- Zitiert nach R. Safranski: Goethe: Kunstwerk des Lebens, Carl Hanser Verlag, 2013, S. 100.
- J. W. von Goethe: Faust I, S. 33.
- Ebd., S. 13.
- Ebd.
- Ebd.
- Ebd., S. 36.
- Zitiert nach R. Safranski: Goethe: Kunstwerk des Lebens, Carl Hanser Verlag, 2013, S. 292.
- J. W. von Goethe: Faust I, S. 54.
- Ebd., S. 57.
- K. Marx: Thesen über Feuerbach, in MEW, Bd. 3, S. 5.
- J. W. von Goethe: Faust I, S. 38.
- Ebd., S. 39.
- Ebd., S. 40.
- Zitiert nach Johannes Hoffmeister (Hg.): Briefe von und an Hegel, Band 3: 1823-183, Felix Meiner Verlag, 1969, S. 83.
- F. Engels (1890): Brief an C. Schmidt, 27. Oktober 1890, in MEW, Bd. 37, S. 492.
- J. W. von Goethe: Faust I, S. 11.
- Ebd., S. 39.
- F. Engels: Ludwig Feuerbach und der Ausgang der klassischen deutschen Philosophie, in MEW, Bd. 21, S. 287.
- J. W. von Goethe: Faust II, S. 11.
- J. W. von Goethe: Faust I, S. 82.
- J. W. von Goethe: Faust II, S. 192.
- K. Marx: Das Kapital, 1. Band, in MEW, Bd. 23, S. 788.
- Zitiert nach C. Hamlin (Hg.): Faust, Norton, 2001, S. 376.
- K. Marx: “Confessions”, in International Review of Social History, Vol. 1, S. 108.
- J. W. von Goethe: Faust I, S. 91.
- J. W. von Goethe: Faust I, S. 75.
- J. W. von Goethe: Faust I, S. 77.
- J. W. von Goethe: Faust I, S. 90.
- J. W. von Goethe: Faust I, S. 128.
- F. Engels: Deutscher Sozialismus in Versen und Prosa, in MEW, Bd. 4, S. 239.
- R. Safranski: Goethe: Kunstwerk des Lebens, Carl Hanser Verlag, 2013, S. 623.
- Zitiert nach C. Hamlin (Hg.): Faust, Norton, 2001, S. 547.
- F. Engels: Anti-Dühring, in MEW, Bd. 20, Berlin, S. 35.
- J. W. von Goethe: Faust I, S. 12.
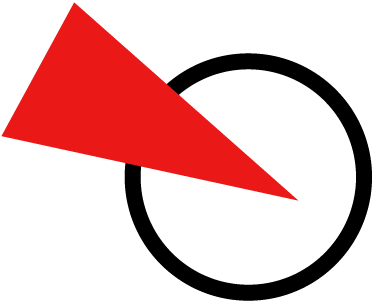
![[Heft] IVdM Nr. 15: Wissenschaft](https://www.1917-verlag.at/wp-content/uploads/2025/03/ivdm-15.webp)