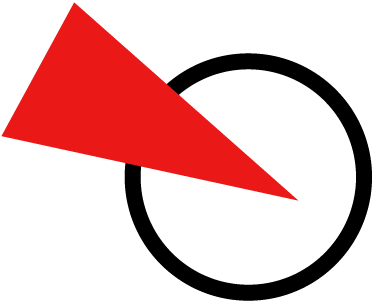Reformismus ist der Glaube, dass gesellschaftliche Übel wie Krieg und Armut schrittweise und ohne den revolutionären Sturz des kapitalistischen Systems beseitigt werden können.
Der Leitartikel der vorliegenden Ausgabe, Lehren aus Griechenland, beschäftigt sich mit diesem Problem. Es drückt sich gewöhnlich in dem Argument aus, die Arbeiterbewegung solle sich darauf beschränken, das zu erkämpfen, was unmittelbar erreichbar sei. Mit jedem kleinen Sieg, so sagt man, gehe es der Arbeiterklasse besser, damit werde sie mächtiger und so beschreite sie langsam, aber sicher den Weg ihrer Befreiung. Jede Diskussion über ein „Endziel“ der Bewegung, über den Sozialismus etwa, wird damit zu einer akademischen Frage.
Vielen erscheint das als realistischere, praktischere Alternative zum Kampf für die sozialistische Revolution. Immerhin scheint das ein Weg zur Veränderung zu sein, der ohne das Risiko von Gewalt oder Instabilität auskommt.
Es gibt Zeiten, in denen diese Argumente auch nicht völlig falsch sind. Während Perioden bedeutender Aufschwünge des Kapitalismus waren die Bosse historisch in der Lage, sich zumindest in den fortgeschrittenen kapitalistischen Ländern bedeutende demokratische und soziale Reformen zu leisten. Die Periode des Aufstiegs der Sozialdemokratie vor dem ersten Weltkrieg war eine solche Periode, ebenso wie die sogenannten „glorreichen dreißig Jahre“ nach dem Zweiten Weltkrieg.
Doch die Geschichte zeigt, dass friedlicher und allmählicher Fortschritt im Kapitalismus unmöglich ist. Zyklische Krisen stürzen das gesamte System immer wieder ins Chaos. Und im Zeitalter des Niedergangs des Kapitalismus sind diese Krisen tiefer und langanhaltender geworden.
Krise
Das 20. Jahrhundert hat gezeigt, wie schnell sich Reformismus in sein Gegenteil verkehren kann. In Europa, der Wiege der Sozialdemokratie, wurde die Zeit des Wohlstands schließlich von Massenarbeitslosigkeit, Bürgerkrieg und vielerorts Faschismus abgelöst.
Indem sie die Ziele, Methoden und selbst die Denkweise der Arbeiterbewegung an die Strukturen des Kapitalismus knüpften, waren die Reformisten nicht in der Lage, die bisherigen Errungenschaften zu verteidigen, geschweige denn neue zu erringen. Schlimmer noch: Viele wirkten an imperialistischen Kriegen und Angriffen auf die Arbeiter mit, um die Stabilität ihrer eigenen kapitalistischen Staaten zu sichern. Trotzki schrieb 1935:
„Ohne Reformen gibt es keinen Reformismus, ohne prosperierenden Kapitalismus keine Reformen. Der rechte Flügel des Reformismus wird antireformistisch, insofern er der Bourgeoisie direkt oder indirekt hilft, die alten Errungenschaften der Arbeiterklasse zu zerschlagen.“
Heute äußert sich die Krise des Kapitalismus auch als Krise des Reformismus.
Seit dem Ende des Nachkriegsbooms in den 1970er Jahren sind die Errungenschaften der Arbeiterklasse weltweit langsam und schmerzhaft zurückgenommen worden. Reformen wurden zu Konterreformen. Dieselbe Labour Party (Großbritannien), die in den 1940er Jahren das Sozialstaatsprinzip „von der Wiege bis zur Bahre“ eingeführt hat, kürzt heute fünf Milliarden Pfund bei den Leistungen für Menschen mit Behinderung.
Nach der Krise von 2008 wandten sich Millionen Arbeiter und Jugendliche nach links und beflügelten weltweit den Aufstieg neuer Bewegungen: Syriza in Griechenland, Podemos in Spanien, Corbyn in Großbritannien, Mélenchon in Frankreich und Sanders in den USA gewannen mit Forderungen nach radikaler Veränderung – oft unter Berufung auf den „Sozialismus“ – Massenunterstützung.
Doch sie alle teilten die Illusion, den Kapitalismus durch kluge Politik und staatliches Eingreifen reparieren zu können. Trotz sozialistischer Rhetorik zielten sie darauf ab, den Kapitalismus zu regulieren, nicht ihn abzuschaffen. Damals wie heute betrachteten sie die Sparpolitik als Entscheidung, hinter der eine hässliche „neoliberale“ Ideologie steckt; nicht als notwendiges Ergebnis der kapitalistischen Krise.
Keiner von ihnen hat irgendeine bedeutende Reform umgesetzt. In Großbritannien kapitulierte Corbyn vor den Antisemitismusvorwürfen der Rechten und vor dem „Brexit“. Das zerstörte seine Bewegung.
Sanders hat seit 2016 jeden Kandidaten des demokratischen Establishments unterstützt, um „Trump zu verhindern“.
In Griechenland gewann Syriza ein historisches Mandat, um gegen die Austerität zu kämpfen, nur um sich dann vor den Forderungen des internationalen Finanzkapitals zu ergeben. Die Folgen für die griechischen Massen waren entsetzlich.
In jedem Fall zogen sich die linksreformistischen Führer zurück, sobald sie auf ernsthaften Widerstand der herrschenden Klasse stießen.
So kam es, dass die „Linke“ heute völlig diskreditiert ist. Doch die Wut in der Gesellschaft ist nicht verschwunden. Stattdessen hat sich ein bedeutender Anteil der Arbeiterklasse, in der Hoffnung, dort einen Ausweg aus der Krise zu finden, an Figuren wie Trump und an Parteien wie „Reform UK“ und die „Alternative für Deutschland“ gewandt.
Verrat
Wie konnte das passieren? Trotzki fasste es zusammen:
„Wer sich vor dem Vollendeten verneigt, ist nicht fähig, die Zukunft vorzubereiten.“
Die Sichtweise aller Reformisten ist durch den gröbsten Empirismus gekennzeichnet. Tatsächlich geben die Reformisten selbst stolz mit ihrem „Pragmatismus“ an. Sie nehmen die unmittelbar vorliegenden „Fakten“ als Ausgangspunkt und stützen dann ihre ganze Strategie drauf.
Unbestreitbar gehört die Wirtschaft den Kapitalisten und sie beherrschen sie. Auch die Existenz und Macht des bürgerlichen Staates ist eine Tatsache. In den sogenannten „liberalen Demokratien“ gehören die gesetzgeberische Tätigkeit des Parlaments, das allgemeine Wahlrecht, die Gewerkschaften usw. zu den Tatsachen des Lebens.
Die meisten Reformisten würden auch zugeben, dass die Arbeiterklasse existiert. Aber dass die Arbeiterklasse den bürgerlichen Staat ersetzt und selbstständig die Gesellschaft verwaltet, finden sie „utopisch“. Warum? Weil es noch nicht so ist.
So kommt es, dass sie den bürgerlichen Staat für „den Staat“ im Allgemeinen halten. Die bürgerliche Demokratie erscheint ihnen als „Demokratie“ schlechthin; kapitalistische Verhältnisse sind einfach „die Wirtschaft“; die ideologischen Prinzipien der herrschenden Klasse, ihre moralischen Prinzipien, werden zu allgemeinen „Werten“ und einer allgemeinen „Moral“.
Für den Reformisten ist also die kapitalistische Ordnung die Ordnung schlechthin – die einzige Ordnung, die es gibt, und die einzige, die es geben kann. Alles, was zum Zusammenbruch dieser Ordnung führen kann, ist daher undenkbar.
Deshalb fürchten reformistische Führer die Bewegungen, die sie entfesseln können. Für sie ist die Arbeiterklasse keine revolutionäre Kraft, die man mobilisiert, um die bestehende Ordnung zu stürzen. Es ist eine Masse, die man „vertritt“. Massenmobilisierungen und Streiks sind also vor allem dafür da, als Verhandlungsmasse gegenüber den Bossen zu dienen.
Wenn die Kämpfe der Arbeiter drohen, die Grundlagen des Systems zu gefährden, ziehen sie sich panisch zurück. Von solchen Führern braucht sich die Arbeiterklasse nichts als Niederlagen zu erwarten.
Sektierertum
Der Marxismus schlussfolgert aus einer wissenschaftlichen Untersuchung des Klassenkampfs in der menschlichen Geschichte, dass nur der bewusste Sturz des Kapitalismus durch die Arbeiterklasse die Übel des Kapitalismus beseitigen kann.
Daher ist es die erste Pflicht echter Kommunisten, für die Klassenunabhängigkeit der Arbeiterbewegung zu kämpfen. Dazu gehört notwendigerweise, sich jedem Versuch zu widersetzen, die Bewegung an den bürgerlichen Staat und seine Institutionen zu binden und jeden dieser Versuche zu entlarven. Das ist der „erste Buchstabe im Alphabet des Kommunismus“, wie Trotzki sagen würde.
Doch jedes Kind weiß, dass es noch mehr Buchstaben gibt. Es ist nämlich notwendig, zwischen dem Reformismus der Arbeiterführer und dem Wunsch der Arbeiterklasse nach Reformen zu unterscheiden.
Oft hängt beides zusammen. Die Reformisten bieten Reformen an und die Arbeiter folgen ihnen, weil sie sich greifbare Verbesserungen versprechen. Einige Marxisten könnten der Versuchung erliegen, die „reformistischen Illusionen“ der Arbeiter einfach zurückzuweisen. Ihre Lösung ist, den Arbeitern mitzuteilen, dass sie einen Fehler machen, dass ihre Führer sie verraten werden und dass sie nicht ihre Zeit damit verschwenden sollten, reformistische Politiker zu wählen.
Abstrakt genommen ist das schön und gut. Man drückt mit einem solchen Argument ja die profunde Wahrheit aus, dass der Reformismus in Zeiten der kapitalistischen Krise nicht imstande ist, die Reformen zu liefern, die die Massen verlangen. Gerade durch seine Abstraktheit würde das Argument aber das Gegenteil von dem erreichen, was es bezweckt, und in der Tat falsch werden.
Die Arbeiterklasse einfach über die Notwendigkeit zu belehren, den Kapitalismus zu stürzen, ohne diese allgemeine Wahrheit mit den konkreten Anforderungen der lebendigen Bewegung zu verknüpfen, ist das Kennzeichen des Sektierertums. Wie Trotzki erklärte:
„Der Sektierer betrachtet das gesellschaftliche Leben als eine große Schule, in der er selbst der Lehrer ist. Nach seiner Meinung soll die Arbeiterklasse ihre weniger wichtigen Angelegenheiten beiseiteschieben und sich in geschlossener Formation um seine Rednertribüne scharen: dann wäre die Aufgabe gelöst.“
Bewusstsein
Es reicht nicht aus, zu behaupten, die Arbeiter müssten revolutionär werden. Man muss verstehen, wie revolutionäres Bewusstsein tatsächlich entsteht. Und es entsteht dialektisch, in dramatischen Sprüngen, angetrieben durch den praktischen Kampf um die Veränderung der Gesellschaft – nicht bloß in der Theorie.
In Krisenzeiten, wenn der Kapitalismus sich nicht einmal mehr grundlegende Reformen leisten kann, können solche Sprünge einen revolutionären Charakter annehmen.
Die Kommunistische Internationale stellte 1922 fest:
„Angesichts der heutigen Gesamtsituation der Arbeiterbewegung wird jede ernsthafte Massenaktion, selbst wenn sie nur mit Teilforderungen beginnt, unvermeidlich die allgemeineren und grundsätzlichen Fragen der Revolution in den Vordergrund rücken.“
Vier Jahre später beteiligten sich mehr als drei Millionen britische Arbeiter an einem Generalstreik unter dem Motto: „Keinen Penny weniger Lohn, keine Minute länger Arbeit.“ Was als Abwehrkampf gegen die Angriffe der Unternehmer begann, wurde zu einer direkten Konfrontation zwischen der Arbeiterklasse und der gesamten Staatsmacht Großbritanniens, in der die Arbeiter hätten die Macht übernehmen können.
Wenn die Massen in Bewegung geraten, wenden sie sich zunächst meist an bekannte Persönlichkeiten und Organisationen. Doch im Verlauf des Kampfes können sie oft weit über die Absichten ihrer Führer hinausgehen. Im Kolumbien entfaltet sich aktuell ein Beispiel dafür.
Der linke Präsident Gustavo Petro versucht, eine Reihe von Reformen durchs Parlament zu bringen. Er hat klargemacht, dass er eine Art „menschlichen Kapitalismus“ – und sicher keinen Sozialismus – in Kolumbien aufbauen möchte. Doch Millionen Arbeiter unterstützen seine Regierung und deren Reformprogramm, weil sie darin den Versuch sehen, ihre dringenden Forderungen nach einem besseren Gesundheitssystem, besseren Pensionen, besseren Arbeitsbedingungen – kurz: nach einem besseren Leben – zu erfüllen.
Doch leider ist der kolumbianische Kapitalismus unfähig, diese Forderungen zu erfüllen. Durch ihre Kontrolle über das Parlament blockiert oder verwässert die herrschende Klasse also Petros Vorschläge. Petro beantwortet das mit Massenmobilisierungen für ein Referendum, genannt consulta popular über einige seiner Reformen. Er hat dabei absolut nicht vor, die Grenzen der bürgerlichen Demokratie zu überschreiten. Er will den Druck der Massen nutzen, um die herrschende Klasse zu einem Kompromiss zu zwingen. Doch Petros Absichten sind nicht dieselben wie die der Arbeiter und Jugend.
Durch den Aufruf Petros aufgerüttelt, haben sich Volksversammlungen namens cabildos gebildet, um die Bewegung zu organisieren. Die kämpferischste Schicht in diesen Versammlungen hat den Aufruf nach einem Paro Nacional, einem „landesweiten Streik“, erhoben. Das war auch der Hauptslogan der Aufstandsbewegung, die 2021 die rechte Regierung von Ivan Duque besiegte.
Je mehr sich die Krise vertieft und sich die Manöver der herrschenden Klasse fortsetzen, desto mehr wird diese Radikalisierung wahrscheinlich anwachsen – und die Massen auf Kollisionskurs mit Petros Reformismus bringen.
Lenin bezeichnete die Momente im Klassenkampf, wenn die Arbeiter sagen: „Wir weichen nicht zurück!“, als wesentliche Bedingung einer Revolution. In Griechenland wurde dieser Moment 2015 erreicht.
Als die Syriza-Regierung ein Referendum über das Sparpaket organisierte, das die Gläubiger des Landes verlangten, konzentrierten sich alle Forderungen der griechischen Massen in einem einzigen Wort: „Όχι!“ (Nein!)
Die Führung hatte nur eine einfache Abstimmung durchführen wollen, um ihre Verhandlungsposition zu stärken. Doch die Massen waren aufgestanden. Ihre Bewegung hätte mit dem Kapitalismus brechen und eine revolutionäre Welle in Europa auslösen können.
Genau hier wird die Frage der Führung entscheidend.
Man hat in Griechenland gesehen, dass die reformistischen Führungen ab einem bestimmten Punkt nicht weiterwissen. Der Gegensatz zwischen ihren Worten und Taten verschärft sich zu einem unerträglichen Grad und die Bewegung gerät in die Krise.
Die Rolle der Kommunisten
Man könnte sich fragen: Wenn die Arbeiter so radikalisiert waren, warum werden sie ihre Führer dann nicht einfach los und ergreifen selbst die Macht?
Wenn die Arbeiter eine revolutionäre Führung einfach improvisieren könnten, dann wäre die revolutionäre Partei unnötig und wir würden bereits im Sozialismus leben. Die Aufgabe der revolutionären Partei besteht nicht darin, die Revolution der Reform gegenüberzustellen, sondern darin, die Brücke zwischen beiden herzustellen. Rosa Luxemburg erklärte in ihrer Broschüre Sozialreform oder Revolution:
„Für die [Marxisten] besteht zwischen der Sozialreform und der sozialen Revolution ein unzertrennlicher Zusammenhang.“
Doch um vom Wort zur Tat zu schreiten, muss die Partei das Vertrauen des Großteils der Arbeiterklasse gewinnen. So hängen strategische Fragen mit taktischen Problemen zusammen.
Kommunisten müssen in der Lage sein, die Welt mit den Augen der Arbeiterklasse zu sehen. Wir müssen als Ausgangspunkt das Bewusstsein der Massen nehmen, wie es heute ist, inklusive aller Illusionen, die sie vielleicht haben – über reformistische Führer, demokratische Forderungen, die nationale Frage usw. – und diese mit der Notwendigkeit verbinden, dass die Arbeiterklasse die Leitung der Gesellschaft übernimmt.
Wenn wir Kommunisten finden, dass die Massen falsche Forderungen oder Führer gewählt haben, müssen wir ihnen die Wahrheit sagen. Aber nicht, indem wir sie von der Seite belehren. Erst einmal müssen wir beweisen, dass wir bereit sind, an ihrer Seite zu kämpfen – auf dem Kampffeld, das sie sich selbst wählen.
Das war die Methode von Marx und Engels; dafür setzte sich Trotzki sein Leben lang ein, vor allem im Übergangsprogramm; und das war die Methode, mit der es der bolschewistischen Partei gelang, im Oktober 1917 die größte Revolution der Geschichte durchzuführen.
Im Frühling 1917 schauten die meisten Arbeiter auf reformistische Parteien wie die Menschewiki. Anstatt einfach zu den Arbeitern zu sagen, sie sollen sich von den Reformisten abwenden, erklärte Lenin öffentlich, diese Parteien sollen selbst die Macht ergreifen, aber auf jede Zusammenarbeit mit der herrschenden Klasse und deren Agenten verzichten. Das war sehr effektiv, weil es genau ausdrückte, was die meisten Arbeiter zu diesem Zeitpunkt wollten, und weil es sichtbar machte, dass die Reformisten die Forderungen der Arbeiter in der Praxis nicht erfüllen konnten.
Ebenso waren die Forderungen der Bolschewiki nach einer Konstituierenden Versammlung und nach der Verteilung des Landes an die Bauern keine sozialistischen Forderungen; sie wurden von den Massen selbst aufgestellt und direkt von ihnen übernommen. Aber die Bolschewiki gaben ihnen einen revolutionären Übergangscharakter, als sie erklärten, dass diese Forderungen nur erfüllt werden konnten, indem die Arbeiter und Bauern durch die Sowjets (Räte), die sie sich im Kampf geschaffen hatten, die Macht ergriffen und sie selbst verwirklichten.
Lenins Rat an die Bolschewiki war: „Geduldig erklären!“ So zogen die Arbeiter ihre eigenen Schlussfolgerungen und wandten sich an die Bolschewiki als einzige Partei, die wirklich die Reformen liefern konnte, für die sie kämpften. Ohne das hätte die Oktoberrevolution niemals stattgefunden.
Unsere Aufgabe
Die kommende Periode wird voller Gelegenheiten für revolutionäre Kommunisten sein, aber auch schwere Prüfungen beinhalten.
Wenn wir es nicht schaffen, die fortgeschrittensten Arbeiter und Jugendlichen von unserem Banner zu überzeugen, dann wird sich jeder Anspruch, eine revolutionäre Alternative zur gegenwärtigen Führung darzustellen, einfach als heiße Luft herausstellen. Der Kampf gegen den Reformismus heute ist nichts anders als der Kampf um die Überwindung unserer eigenen Isolation.
In Ländern, wo die revolutionären Kommunisten jetzt erst anfangen, sich zu organisieren, bleibt der Kampf um die Avantgarde der Arbeiterklasse noch eine Zukunftsvision. Doch selbst hier müssen wir umfassend gebildete marxistische Kader, echte Kommunisten, ausbilden, die nicht nur die Fehler der Arbeiterführer, sondern auch die Gefühle der Arbeiter selbst verstehen können. Nur so können wir die Kräfte des Kommunismus weltweit stärken.
Das Verhältnis zwischen dem Kampf für Reformen, dem Reformismus, und der Revolution zu verstehen, ist der Prüfstein für jede revolutionäre Strömung. Versteht sie es nicht, wird sie höchstens eine kommunistische Propagandagruppe, aber niemals die Partei der proletarischen Revolution.
Das ist unsere Aufgabe: Wenn wir erfolgreich sein wollen, müssen wir die Lehren der Vergangenheit verstehen.