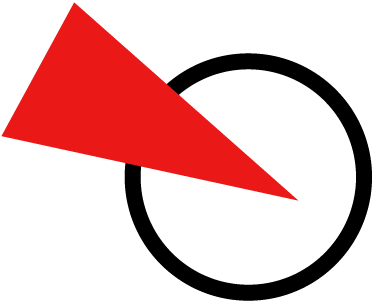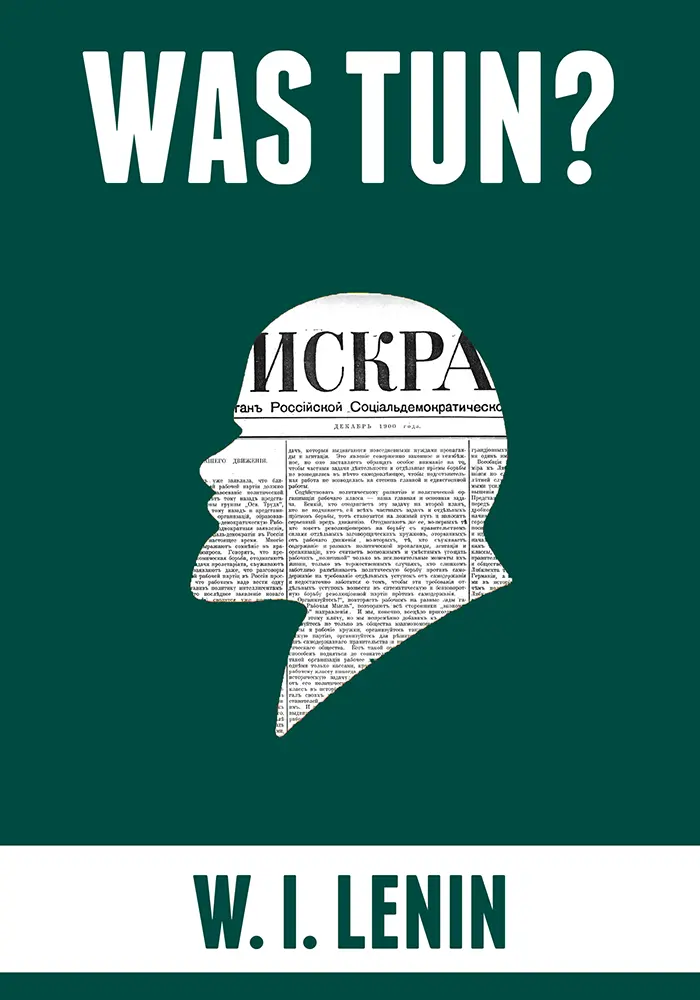Von Rob Sewell. Erschienen als Vorwort zur englischen Ausgabe 2018.
Lenins ›Was tun?‹ ist ein Klassiker des Marxismus über den Aufbau der revolutionären Partei. Es ist auch der Text, der am häufigsten von Reformisten und Akademikern kritisiert wird, weil er angeblich schon die Saat einer totalitären Diktatur enthält.
Ein Beispiel für die Flut an giftigen Kommentaren, mit denen Lenin überschüttet wird, ist folgender Ausschnitt aus Anthony Reads ›The World on Fire‹ (London, 2008):
»Der Bolschewismus wurde auf einer Lüge gegründet und schuf ein Exempel, dem die nächsten 90 Jahre lang gefolgt werden sollte. Lenin hatte keine Zeit für Demokratie, kein Vertrauen in die Massen und keine Skrupel vor Gewaltanwendung. Er wollte eine kleine, straff organisierte und streng disziplinierte Partei von hartgesottenen Berufsrevolutionären, die genau das tun würden, was man ihnen sagte.«
Dieser offene Hass sollte uns nicht überraschen. Aber mit der Wahrheit hat das nichts zu tun. Während Marx von bürgerlicher Seite hier und da ein paar Komplimente für seine Analyse der kapitalistischen Krise einheimst, sind sie mit Lenin nicht so gnädig. Unerbittlich fällt eine unheilige Allianz über ihn her und zieht ihn in den Dreck. Der Grund dafür liegt darin, dass Lenin eine Partei aufgebaut hat, die die sozialistische Revolution anführen konnte und den Arbeitern auf der ganzen Welt gezeigt hat, wie man den Kapitalismus konkret stürzen kann.
Seitdem versuchen die Bürgerlichen, das wahre Wesen von Lenins Lebenswerk zu vertuschen, indem sie den Leuten weismachen, dass Stalinismus und Leninismus eigentlich dasselbe sind. Diesem Gedanken stimmen Liberale, Demokraten, Reformisten, Idealisten, Pragmatiker und Anarchisten gleichermaßen zu.
Ungeachtet dieser bodenlosen Verleumdungen hat ›Was tun?‹ einen wichtigen Platz in der marxistischen Literatur und ist ein Meilenstein in der Geschichte des russischen Marxismus, der von allen, die die Gesellschaft verändern wollen, ernsthaft studiert werden sollte.
Der Grund, warum dieses Werk bisher nicht ausreichend beachtet wurde, mag darin liegen, dass das Buch eine Übertreibung enthält. Der Autor überspannte den Bogen, indem er behauptete, dass die Arbeiterklasse auf sich alleine gestellt nur ein gewerkschaftliches Bewusstsein erreichen kann.
Das ist offensichtlich nicht der Fall. Angefangen bei den britischen Chartisten hat die Geschichte oft gezeigt, dass die Arbeiterklasse im Kampf ein sozialistisches Bewusstsein entwickeln kann. Tatsächlich hat Lenin, wie das Buch zeigt, diese Idee von Karl Kautsky entlehnt, der damaligen Leitfigur in der deutschen Sozialdemokratie und der Zweiten Internationale.
Fakt ist, dass Lenin diese falsche Formulierung nach einer einzigen Erwähnung nie mehr wiederholt hat und später im Buch sogar einräumt, dass das »vereinfacht krass« und eine »schroffe Formulierung« ist. Er wählte sie, um die opportunistische Abweichung der russischen Ökonomisten (eine rechte Strömung in der damaligen Bewegung) anzugreifen, die die Rolle der revolutionären Partei kleinredeten und faktisch abstritten.
Trotz dieser einen Übertreibung beinhaltet Lenins ›Was tun?‹ einen Schatz an Wissen über die Bedeutung der revolutionären Partei, ein Thema, das heute viel mehr Aufmerksamkeit verdient. Nadeschda Krupskaja, Lenins Ehefrau und Kampfgenossin, empfahl das Studium jedem, »der nicht nur mit Worten, sondern durch die Tat Leninist sein will.«
Das Buch wurde Anfang 1902 veröffentlicht und von den marxistischen Zirkeln in Russland mit großer Begeisterung aufgenommen.
»Ganz besonderen Erfolg hatte die Broschüre ›Was tun?‹«, schrieb Krupskaja, »Sie beantwortete eine Reihe der aktuellsten, dringendsten Fragen. Die Notwendigkeit einer konspirativen, planmäßig arbeitenden Organisation wurde allgemein als sehr dringend empfunden.«
»Die Broschüre war ein einziger leidenschaftlicher Appell, sich zu organisieren. Sie entwarf einen breit angelegten Organisationsplan, in dem jeder seinen Platz finden, in dem jeder ein Rädchen des revolutionären Mechanismus werden konnte, ein Rädchen, ohne das, so geringfügig es an sich sein mochte, der ganze Mechanismus nicht zu arbeiten imstande war.«
Lenins Werk leistete einen wichtigen Beitrag in diesen frühen Jahren der revolutionären Bewegung in Russland. Es sollte gemeinsam mit seinen anderen Artikeln aus derselben Zeit gelesen werden, allen voran mit dem ergänzenden ›Womit beginnen?‹. (Siehe S. 29 in dieser Ausgabe.)
Lenin eröffnet ›Womit beginnen?‹ folgendermaßen:
»Die Frage ›Was tun?‹ drängt sich in den letzten Jahren den russischen Sozialdemokraten mit besonderer Kraft auf. Es handelt sich dabei nicht um die Wahl des Weges (wie das Ende der achtziger und Anfang der neunziger Jahre der Fall war), sondern darum, welche praktischen Schritte wir auf dem erkannten Weg tun sollen, und auf welche Art wir sie tun sollen. Es handelt sich um das System und den Plan der praktischen Tätigkeit.«
Sein späteres Buch war schlichtweg eine Entwicklung dieser grundlegenden Ideen.
Ideologische Klarheit
Schon eine ganze Weile herrschte eine Auseinandersetzung zwischen dem Marxismus und dem Populismus [die s.g. ›Narodniki‹ oder ›Narodowolzen‹], wobei letzterer sich nicht auf den Klassenkampf, sondern den individuellen Terror stützte; später entbrannte ein Streit mit den Anhängern des ›Legalen Marxismus‹, der das revolutionäre Wesen des Marxismus aufgegeben hatte.
Mit seinem Buch nahm Lenin den Kampf gegen den Opportunismus der sogenannten ›Ökonomisten‹ auf, die einen gewissen Zuspruch hatten. Durch diese ideologischen Kämpfe nahm der russische Marxismus Gestalt an.
Aus Lenins Schriften kommt klar heraus, dass der Aufbau der revolutionären Partei ein komplexer Prozess ist, der verschiedene Stadien durchläuft und sich über mehrere Jahre und sogar Jahrzehnte hinweg entfaltet. Diese Geburtswehen können schmerzhaft sein, und die Partei unterliegt einem ständigen Kristallisationsprozess, Umgruppierungen und auch Spaltungen, bevor sie sich als Massenkraft etablieren kann. ›Was tun?‹ war Teil dieser Entwicklung.
Die Russischen Ökonomisten behaupteten, dass die Arbeiter sich nur für die ökonomischen bzw. die Fragen des »täglichen Brots« interessieren würden. Diesen Zugang kann man als »Workerismus« zusammenfassen – der Versuch, mit einer Absenkung des politischen Niveaus eine Abkürzung zu den Massen zu finden. Trotz dieser Demagogie war das keine proletarische Strömung, sondern die Wichtigtuerei von Intellektuellen, die glaubten, die Arbeiter gewinnen zu können, indem sie sich ihren angeblichen Vorurteilen anpassen. Diese Versuche, sich an die Massen anzubiedern, sind jedoch nie erfolgreich.
Lenin schrieb dieses Buch Ende 1901/Anfang 1902, um die »brennenden Fragen unserer Bewegung« zur Organisation zu beantworten und gleichzeitig um den rechten Parteiflügel zu kritisieren. Zu der Zeit sammelten sich die russischen Marxisten um ihre Zeitung ›Iskra‹, die einen Kampf darum führte, die Partei auf der Grundlage von festen theoretischen Prinzipien aufzubauen.
Lenins Buch ist ohne Frage ein wichtiger Beitrag zur Theorie und erklärt die zentrale Rolle der revolutionären Partei als Organisatorin und Dirigentin der proletarischen Revolution. Fakt ist: Lenins Lebenswerk ist einzigartig, was das Verständnis für die wesentliche Rolle der Partei angeht. Sein Genie erlaubte es ihm, die Bedeutung der Partei weitaus klarer zu sehen als jeder andere in der Bewegung.
Für Lenin war die zentralisierte Partei notwendig, um die Massen in der Revolution zum Sieg zu führen. Er verstand, dass so eine Partei nicht improvisiert werden kann, »denn in der Zeit der Explosionen und der Ausbrüche ist es schon zu spät, eine Organisation zu schaffen.« Stattdessen muss sie schon vor dem Eintreten solcher Ereignisse bewusst aufgebaut werden, angefangen mit dem Aufbau eines Kaders von »Berufsrevolutionären«.
Berufsrevolutionäre
In Anbetracht der Aufgaben, die auf die revolutionäre Partei warten, kann sie kein stümperhafter, loser Haufen sein, sondern muss auf den Grundsätzen einer zentralisierten Partei, bekannt als demokratischer Zentralismus, aufbauen. Damit verfügt sie über die wirksamste demokratische Organisationsform.
Auf dieser Basis beschließt die Mehrheit ihre Politik und Prioritäten nach einer demokratischen Diskussion innerhalb ihrer Reihen, die in einem Kongress den höchsten Ausdruck findet. Diese werden dann die offizielle Politik für die gesamte Partei. Lenins Konzept war nichts Neues, sondern orientierte sich am Beispiel der von ihm hoch geschätzten Partei der deutschen Sozialdemokratie.
Er selbst betonte seinen Mangel an Originalität am zweiten Kongress der SDAPR (Sozialdemokratische Arbeiterpartei Russlands): »Und ich dachte auch auf dem zweiten Parteitag nicht daran, speziell meine eigenen Formulierungen, die ich in ›Was tun?‹ gegeben hatte, für etwas ›Programmatisches‹, besondere Prinzipien Darstellendes auszugeben.« (Lenin, Vorwort zum Sammelband »12 Jahre«)
Heute bestreiten Reformisten und Ex-Marxisten gerne das Wesentliche von Lenins Position, indem sie sie so darstellen, als wäre sie nur unter den Bedingungen des damaligen zaristischen Russlands gültig gewesen. Aber es ist falsch, zu sagen, dass Lenins Kampf um den Aufbau der bolschewistischen Partei auf die Einzigartigkeit Russlands zurückzuführen ist.
Natürlich waren die Bedingungen im zaristischen Russland extrem schwierig und erforderten die Arbeit im Untergrund. Zum Beispiel konnten Parteikongresse wegen drohender Verhaftungen und Repressionen nicht innerhalb Russlands stattfinden. Das war das Schicksal des Gründungskongresses der SDAPR im Jahr 1898, nach dem die führenden Teilnehmer kurz darauf festgenommen wurden. Plechanows Gruppe ›Befreiung der Arbeit‹ konnte nur im Exil tätig sein. Genauso musste die ›Iskra‹ im Ausland publiziert und dann zurück nach Russland geschmuggelt werden.
Nichtsdestotrotz war Lenins Organisationstheorie nicht einfach nur von den Verhältnissen in Russland bestimmt. Sie beruhte auf der Notwendigkeit, eine Partei aufzubauen, die die Arbeiterklasse an die Macht führen konnte. Die Bedeutung einer solchen Partei ergibt sich aus der historischen Erfahrung. Noch nie in der Geschichte hat die herrschende Klasse ihre Privilegien kampflos aufgegeben, sondern bis aufs Letzte verteidigt. Die Geschichte zeigt, dass die revolutionäre Klasse eine Partei und eine Führung braucht, die bereit ist, diese Herausforderung zu meistern. Trotz der heldenhaften Rolle der Massen zeigt die Erfahrung, dass die Revolution ohne eine solche Partei nicht gelingen wird.
Der Erfolg der Oktoberrevolution hat die Bedeutung der bolschewistischen Partei bewiesen. Umgekehrt können die Niederlagen, die die Arbeiterklasse in den letzten 100 Jahren erlitten hat, auf das Scheitern, eine solche Partei aufzubauen, zurückgeführt werden. Letztendlich ist das ungelöste Führungsproblem das entscheidende Hindernis zwischen der Arbeiterklasse und dem Sieg des Sozialismus. Das ist, was mit »der Frage der Partei« gemeint ist. Solange die Arbeiterklasse diese Frage – und diese Frage ist an sich ein bewusster Ausdruck des revolutionären Prozesses – nicht gelöst hat, wird die Frage der Arbeitermacht nicht gelöst werden können.
Aufgrund der zahlreichen Niederlagen der Vergangenheit und der langgezogenen Entwicklung der Ereignisse in den letzten Jahrzehnten, haben Viele jegliche Hoffnung in den Aufbau dieser Partei verloren. Sie wurden skeptisch und brannten aus.
Anstatt zuerst eine Kaderorganisation und dann die Partei aufzubauen, glauben sie, dass der Weg nach vorne darin besteht, »die Bewegung« oder »die Linke« aufzubauen. Sie verstehen nicht, dass man eine Bewegung nicht künstlich aufbauen kann. Die Bewegung der Arbeiterklasse wird in erster Linie von großen Ereignissen angeschoben. Wer das nicht versteht, endet unweigerlich im Sumpf des Reformismus, vor allem in dessen »linkem« Milieu. Die heutige Arbeiterbewegung ist vollgemüllt mit solchen Typen.
Auch wenn Lenins Buch viele allgemeine Lehren enthält, wurde es spezifisch als Antwort auf die konkreten Probleme der frühen »Zirkel«periode der russischen Bewegung geschrieben. 1907 betonte Lenin in einem Vorwort seiner Schriften diesen Punkt:
»Der Grundfehler jener, die heute gegen ›Was tun?‹ polemisieren, ist der, dass sie dieses Werk völlig aus dem Zusammenhang einer bestimmten historischen Situation, einer bestimmten, jetzt schon längst vergangenen Entwicklungsperiode unserer Partei herausreißen. In diesen Fehler verfiel zum Beispiel ganz deutlich Parvus (ich spreche schon gar nicht von den zahlreichen Menschewiki), der viele Jahre nach Erscheinen der Broschüre die darin enthaltenen Gedanken über die Organisation von Berufsrevolutionären als falsch oder übertrieben bezeichnete. …
Gegenwärtig davon zu sprechen, dass die ›Iskra‹ (in den Jahren 1901 und 1902!) den Gedanken der Organisation von Berufsrevolutionären übertrieben habe, ist dasselbe, als hätte jemand nach dem Russisch-Japanischen Krieg den Japanern vorwerfen wollen, sie hätten die militärischen Kräfte Russlands übertrieben eingeschätzt und sich vor dem Krieg übertriebene Sorge um den Kampf gegen diese Kräfte gemacht. Die Japaner mussten alle Kräfte gegen ein mögliches Maximum der russischen Kräfte anspannen, um den Sieg zu erringen. Leider urteilen viele nur von außen her über unsere Partei, ohne die Sache zu kennen, ohne zu sehen, dass heute die Idee der Organisation von Berufsrevolutionären bereits einen vollen Sieg errungen hat. Dieser Sieg aber wäre unmöglich gewesen, wenn man diese Idee seinerzeit nicht in den Vordergrund gerückt hätte, wenn man sie nicht in ›übertriebener‹ Weise den Leuten gepredigt hätte, die ihrer Verwirklichung hemmend im Wege standen.«
Lenin fuhr fort:
»Die ›Iskra‹ kämpfte für die Schaffung einer Organisation von Berufsrevolutionären, sie kämpfte besonders energisch dafür in den Jahren 1901 und 1902, sie überwand den damals vorherrschenden ›Ökonomismus‹, sie schuf diese Organisation endgültig im Jahre 1903, hielt trotz der darauf folgenden Spaltung unter den Iskristen, trotz aller Aufregungen der Sturm-und-Drang-Periode an dieser Organisation fest, hielt daran im Laufe der ganzen Russischen Revolution fest und bewahrte sie von 1901/1902 bis 1907.« (Lenin, Vorwort zum Sammelband »12 Jahre«.)
Daran festzuhalten ermöglichte schließlich den Sieg im Oktober 1917.
Als Lenin Anfang 1902 ›Was tun?‹ veröffentlichte, hießen alle Unterstützer der ›Iskra‹ die Schlussfolgerungen des Buches willkommen. Sie sahen es als wichtigen Beitrag zur Entwicklung der Partei an. Doch die bittere Spaltung am zweiten Parteitag im Sommer 1903 eröffnete eine Tirade gegen ›Was tun?‹. »Jetzt aber traten die Meinungsverschiedenheiten vor dem Parteitag zutage, und alle, die der ›Iskra‹, Plechanow und Lenin grollten, bemühten sich, die Differenzen zu einer großen prinzipiellen Frage aufzubauschen«, erklärte Krupskaja. »Man fing an, Lenin wegen des Artikels ›Womit beginnen?‹ und wegen der Broschüre ›Was tun?‹ anzugreifen, bezichtigte ihn des Ehrgeizes und ähnliches mehr.« (N. Krupskaja, Erinnerungen an Lenin.)
Hier begann der Mythos, dass Lenins angeblich elitären Vorstellungen über die Organisation, Berufsrevolutionäre und dergleichen zu einer Diktatur innerhalb der Partei führen würden. In der Folge behaupteten bürgerliche Akademiker und Reformisten, dass diese Organisationsmethoden schlussendlich im Stalinismus enden würden. Aber das ist komplett falsch. Der Stalinismus entstand aus der Isolation der Revolution in einem rückständigen Land und nicht wegen irgendwelchen organisatorischen Normen.
Homogenität
Lenin stellt ›Was tun?‹ bekanntlich ein Zitat aus Lassalles Brief an Marx vom 24. Juni 1852 voran. Das ist kein Zufall und dient dazu, den ernsten Ton des restlichen Buches anzugeben.
»Dass die Parteikämpfe gerade einer Partei Kraft und Leben geben, dass der größte Beweis der Schwäche einer Partei das Verschwimmen derselben und die Abstumpfung der markierten Differenzen ist, dass sich eine Partei stärkt, indem sie sich purifiziert, davon weiß und befürchtet die Behördenlogik wenig!«
Kleinbürgerliche Spießer sträuben sich gegen die Vorstellung einer »Säuberung« zur Stärkung der Partei, insbesondere im Lichte der Erfahrungen mit dem Stalinismus. Das Wort »Säuberung« hat heute einen völlig anderen Beiklang als 1852 oder 1902. Es ist nicht von der Hand zu weisen, dass eine wirklich homogene, einheitliche Partei viel stärker ist als eine heterogene. Im Laufe der Zeit kann die Partei alle möglichen zufälligen Elemente anziehen, die klassenfremde Ideen hineintragen und eine sehr schlechte Rolle spielen können. Die Partei ist kein Spielplatz für solche Leute. Es war viel besser, sich politisch von denjenigen zu trennen, die den entgegengesetzten Weg einschlugen.
Marx erklärte schon, dass die revolutionäre Partei ein lebendiger Organismus ist, der verschiedene Entwicklungsstufen durchmacht. Der Übergang vom kleinen Zirkel zu einer größeren Gruppe erfordert eine Änderung der Methoden, und dasselbe gilt für den Übergang zur Massenpartei. Tendenziell werden manche, die in einer Periode eine Rolle gespielt haben, in der nächsten Phase der Organisationsentwicklung zurückbleiben. An einem gewissen Punkt kann das zu Reibungen und sogar Spaltungen führen. Man kann Spaltungen bedauern, aber manchmal sind sie unausweichlich und sogar notwendig. So wie ein Mensch abgestorbene Zellen loswird, oder sich von ihnen »säubert«, damit neue Zellen an ihrer Stelle wachsen können, findet ein ähnlicher Prozess innerhalb der Partei statt.
Lenin schreibt, dass die frühen Jahre der russischen Arbeiterbewegung zwangsläufig von kleinen marxistischen Zirkeln dominiert waren. Diese Zirkel spielten eine fortschrittliche Rolle, letztendlich wurden sie aber zu einem Hindernis für die weitere Entwicklung der Partei.
»Der Übergang zur demokratischen Organisation der Arbeiterpartei, wie er von den Bolschewiki in der ›Nowaja Shisn‹ im November 1905 im selben Augenblick angekündigt wurde, wo die Voraussetzungen für eine offene Betätigung geschaffen waren – dieser Übergang war seinem Wesen nach bereits ein unwiderruflicher Bruch mit all dem, was sich im alten Zirkelwesen überlebt hatte…« (Vorwort zum Sammelband »12 Jahre«)
Wie die gesamte Geschichte des Bolschewismus zeigt, können politische Differenzen und Debatten über Strategie und Taktik sehr hitzig werden. Lenins bolschewistische Partei war als »harte Schule« bekannt. Sie führten viele Polemiken. Lenin bemerkte dazu im Jahr 1907:
»In der Broschüre ›Was tun?‹ wie in der im Weiteren abgedruckten Broschüre ›Ein Schritt vorwärts, zwei Schritte zurück‹ kann der Leser einen leidenschaftlichen, manchmal geradezu erbitterten Vernichtungskampf der Auslandszirkel gegeneinander erkennen. Zweifellos hat dieser Kampf viel Unschönes an sich.« (Ebenda)
Nichtsdestotrotz war das Ergebnis solcher Auseinandersetzungen eine neue politische Klarheit, die der Partei mehr Zusammenhalt und Selbstvertrauen verlieh.
Zeit seines Lebens verteidigte Lenin entschlossen die revolutionären Prinzipien und den Marxismus. Als ›Was tun?‹ herauskam, ging der Kampf gegen die russischen Ökonomisten gerade auf seinen Abschluss zu. Im Vorwort des Buches hält Lenin fest: »Wir können nicht vorwärtsschreiten, wenn wir diese [ökonomistische] Periode nicht endgültig liquidieren.« Das Buch diente dazu, mit dieser opportunistischen Strömung abzurechnen.
Lenin erklärte weiter, dass die Argumente im Kampf gegen den Marxismus von den bürgerlichen Intellektuellen an den Universitäten entwickelt wurden, von wo aus sie in die Hände der Reformisten und Opportunisten innerhalb der Arbeiterbewegung gelangten und zu ihrem Handwerkszeug wurden. Das ist auch heute noch der Fall.
Bis heute wird an den Universitäten der schlimmste ideologische Müll produziert. Die Kader der revolutionären Partei brauchen daher das theoretische Rüstzeug, um auf die Argumente ihrer politischen Gegner zu antworten, vor allem in den sogenannten Hallen des Lernens. Lenin verwendet den ganzen ersten Abschnitt von ›Was tun?‹ darauf, um zu erklären, dass die ökonomistische Strömung ein Teil der opportunistischen Strömung innerhalb der internationalen Arbeiterbewegung war, so wie die Revisionisten unter Eduard Bernstein in Deutschland und Millerand in Frankreich. Lenin verstand seinen Kampf gegen den Ökonomismus in Russland als Teil dieses internationalen Kampfes.
Freiheit der Kritik
Lenin griff die von den Ökonomisten geforderte »Freiheit der Kritik« als modische Losung derjenigen an, die die »Sozialdemokratie in gewerkschaftliche Bahnen lenken« wollten. Er sah diese »Freiheit der Kritik« als klaren Versuch, klassenfremde Ideen in die revolutionäre Partei einzuschleusen. Er erklärte:
»Beurteilt man die Menschen nicht nach der glänzenden Uniform, die sie sich selber angelegt, nicht nach dem effektvollen Namen, den sie sich selber beigelegt haben, sondern danach, wie sie handeln und was sie in Wirklichkeit propagieren, so wird es klar, dass die ›Freiheit der Kritik‹ die Freiheit der opportunistischen Richtung in der Sozialdemokratie ist, die Freiheit, die Sozialdemokratie in eine demokratische Reformpartei zu verwandeln, die Freiheit, bürgerliche Ideen und bürgerliche Elemente in den Sozialismus hineinzutragen. … Das jetzt laut gewordene Geschrei ›Es lebe die Freiheit der Kritik!‹ erinnert allzu sehr an die Fabel vom leeren Fass.«
Lenin wehrte sich insbesondere gegen diejenigen, die versuchen wollten, die revolutionäre Politik zu verwässern oder ganz aufzugeben. Im Gegenzug warfen diese ihm vor, zu keinen Kompromissen bereit und ein Sektierer zu sein. Lenin aber warnte seine Genossen davor, sich von denjenigen in den Sumpf reißen zu lassen, die sie in eine opportunistische Richtung lenken wollten. Er stellte die Frage äußerst scharf, aber sehr deutlich:
»Wir sind von allen Seiten von Feinden umgeben und müssen fast stets unter ihrem Feuer marschieren. Wir haben uns, nach frei gefasstem Beschluss, eben zu dem Zweck zusammengetan, um gegen die Feinde zu kämpfen und nicht in den benachbarten Sumpf zu geraten, dessen Bewohner uns von Anfang an dafür schalten, dass wir uns zu einer besonderen Gruppe vereinigt und den Weg des Kampfes und nicht den der Versöhnung gewählt haben. Und nun beginnen einige von uns zu rufen: Gehen wir in diesen Sumpf! Will man ihnen ins Gewissen reden, so erwidern sie: Was seid ihr doch für rückständige Leute! Und ihr schämt euch nicht, uns das freie Recht abzusprechen, euch auf einen besseren Weg zu rufen! – O ja, meine Herren, ihr habt die Freiheit, nicht nur zu rufen, sondern auch zu gehen, wohin ihr wollt, selbst in den Sumpf; wir sind sogar der Meinung, dass euer wahrer Platz gerade im Sumpf ist, und wir sind bereit, euch nach Kräften bei eurer Übersiedlung dorthin zu helfen. Aber lasst unsere Hände los, klammert euch nicht an uns und besudelt nicht das große Wort Freiheit, denn wir haben ja ebenfalls die ›Freiheit‹, zu gehen, wohin wir wollen, die Freiheit, nicht nur gegen den Sumpf zu kämpfen, sondern auch gegen diejenigen, die sich dem Sumpfe zuwenden!«
In ›Was tun?‹ beschreibt Lenin die Weltanschauung der Ökonomisten als Strömung, die der Theorie völlig verächtlich gegenübersteht.
Theorie, so sagten sie, interessiere die Arbeiter nicht. »Unsere Sache ist die Arbeiterbewegung«, bekunden die Ökonomisten, »sind die Arbeiterorganisationen hier, an dem Ort, wo wir leben, alles Übrige sind Hirngespinste von Doktrinären, ist eine ›Überschätzung der Ideologie‹.«
Hinter dem ständigen Gerede von der »Bewegung der Arbeiterklasse« versteckte sich ihre tatsächliche Geringschätzung für die Arbeiter. Wie die Sektierer heute glaubten sie, dass die Arbeiter nicht schlau genug wären, um die Theorie zu verstehen. Deshalb müsse sich die revolutionäre Bewegung auf die »Fragen des täglichen Brotes« konzentrieren. Die Sekten laufen den Arbeitern hinterher und erzählen ihnen, wie schlecht es um die Dinge steht. Aber die Arbeiter sind nicht dumm und wissen selbst ganz genau, dass ihre Löhne und Arbeitsbedingungen schlecht sind. Dieser Ansatz war das Markenzeichen der Ökonomisten. Elementare Forderungen und Losungen sind zwar wichtig, aber in dieser Epoche der tiefen Krise suchen die Arbeiter zunehmend nach umfassenderen Erklärungen und nicht nur reine Agitation.
Verachtung für Theorie
Lenin nimmt als Beispiel die Zeitung der Ökonomisten, das ›Rabotscheje Delo‹, in dem feierlich die Worte von Marx zitiert wurden: »Jeder Schritt wirklicher Bewegung ist wichtiger als ein Dutzend Programme.« Die Ökonomisten verdrehten diese Worte und meinten, die Arbeiter bräuchten keine revolutionären Ideen und Theorien, sondern nur allgemeine Aktivität. Lenin entgegnete ihnen:
»Diese Worte in einer Zeit der theoretischen Zerfahrenheit wiederholen ist dasselbe, als wolle man beim Anblick eines Begräbnisses ausrufen: ›Mögen euch immer so glückliche Tage beschieden sein!‹
Zudem sind die Worte von Marx seinem Brief über das Gothaer Programm entnommen, in dem er den bei der Formulierung der Prinzipien zugelassenen Eklektizismus scharf verurteilt: Wenn man sich schon vereinigen musste, schrieb Marx an die Parteiführer, so hätte man einfach eine Übereinkunft abschließen sollen, um praktische Ziele der Bewegung zu befriedigen, sich aber auf keinen Prinzipienschacher einlassen, keine theoretischen ›Zugeständnisse‹ machen dürfen. Das war Marx‘ Gedanke, bei uns aber finden sich Leute, die in seinem Namen die Bedeutung der Theorie herabzusetzen suchen!«
Der grundlegende Gedanke, der sich durch Lenins Werk zieht, ist die Notwendigkeit, marxistische Kader – Berufsrevolutionäre – auszubilden, die über ein tiefes Verständnis der marxistischen Theorie verfügen.
»Ohne revolutionäre Theorie kann es auch keine revolutionäre Bewegung geben. Dieser Gedanke kann nicht genügend betont werden in einer Zeit, in der die zur Mode gewordene Predigt des Opportunismus sich mit der Begeisterung für die engsten Formen der praktischen Tätigkeit paart.«
Das war Lenins Seitenhieb gegen den auch heute in der Linken so beliebten gedankenlosen Aktivismus. Lenin war natürlich nicht gegen Aktivität im Allgemeinen, aber sie muss mit einer Hebung des politischen und theoretischen Niveaus einhergehen.
Um diesen Punkt zu unterstreichen, zitiert Lenin die Worte von Friedrich Engels aus dem Jahr 1874, als dieser die Wichtigkeit der Theorie im Aufbau der Bewegung betonte:
»Engels spricht nicht von zwei Formen des großen Kampfes der Sozialdemokratie (dem politischen und dem ökonomischen) – wie das bei uns üblich ist –, sondern von drei, indem er neben diese auch den theoretischen Kampf stellt.«
Denjenigen, die in Großbritannien für den Marxismus kämpfen, gibt Engels einen aufschlussreichen Hinweis. Er erklärt, dass die »Gleichgültigkeit gegen alle Theorie« eine der Hauptursachen dafür war, dass die britische Arbeiterbewegung »so langsam vom Flecke kommt« und betont weiter:
»Es wird namentlich die Pflicht der Führer sein, sich über alle theoretischen Fragen mehr und mehr aufzuklären, sich mehr und mehr von dem Einfluss überkommener, der alten Weltanschauung angehöriger Phrasen zu befreien und stets im Auge zu behalten, dass der Sozialismus, seitdem er eine Wissenschaft geworden, auch wie eine Wissenschaft betrieben, d. h. studiert werden will.« (Vgl. Marx & Engels, ›Werke‹ (MEW), Bd. 18, S. 516f.)
Aus unserer Sicht haben wir diesen Rat von Engels auf Punkt und Komma und mit der gebotenen Ernsthaftigkeit befolgt. Wir müssen unsere Mitstreiter ständig darin schulen, als Marxisten zu denken, um dem Druck des Opportunismus (der nichts anderes ist, als der Druck des Kapitalismus selbst) innerhalb der Bewegung zu widerstehen.
Es erscheint seltsam, dass wir von unseren Gegnern für unsere Anerkennung der zentralen Bedeutung, die wir der marxistischen Theorie beimessen, verspottet werden. Aber wir befinden uns in guter Gesellschaft. »Diese Leute, die das Wort ›Theoretiker‹ nicht in den Mund nehmen können, ohne eine verächtliche Grimasse zu ziehen«, so Lenin, sind genau diejenigen, die sich in ihrer eigenen Unwissenheit suhlen. Wir kennen diese Art von Leuten, die Zyniker und Skeptiker mit ihrer Verachtung für die Theorie, nur zu gut. Es ist ein Spiegelbild ihrer Verachtung für die Arbeiterklasse. Die Theorie ist, im Grunde genommen, nur die vergangene, verallgemeinerte Erfahrung der Arbeiterklasse. Unsere Theorie ist kein akademischer Diskurs, sondern eine Anleitung zum Handeln.
Während Lenin seine Übertreibung, der Arbeiterklasse müsse ein sozialistisches Bewusstsein von außen gebracht werden, nie wiederholt hat, ist jeder Sektierer unter der Sonne schon in diesen Irrtum verfallen, um seine hochmütige Rolle als cleverer Missionar zu rechtfertigen, der von außen kommt, um die Arbeiterbewegung zu führen.
Lenin hat den »Bogen überspannt«, wie wir schon gesehen haben, als er die Grenzen der Spontaneität richtig aufzeigte (»sklavische Anbetung der Spontaneität«), die das Markenzeichen der Ökonomisten war.
»Im Gegenteil, ich wandte den später so oft zitierten Vergleich mit dem überspannten Bogen an. In ›Was tun?‹ wird der von den ›Ökonomisten‹ überspannte Bogen wieder ausgerichtet, sagte ich … Der Sinn dieser Worte ist klar: ›Was tun?‹ korrigiert polemisch den ›Ökonomismus‹, und es ist falsch, den Inhalt der Broschüre außerhalb dieser Aufgabe zu betrachten.«
Die Ökonomisten sind immer hinter den Vorurteilen der Arbeiter zurückgeblieben und versuchten ihnen Dinge zu erklären, die sie bereits wussten. Demagogisch stellten sie den Slogan auf: »Die Arbeiter für die Arbeiter« und sprachen davon, dass »nicht die ›Elite‹ der Arbeiter, sondern der ›Durchschnitts‹arbeiter, der Arbeiter aus der Masse« die Hauptsache sei. Das war einfach nur eine Anbiederung an das Rückständige in der Arbeiterklasse. Aber die Arbeiterklasse hat in verschiedenen Perioden ihre starke und ihre schwache Seite. Sie hat das Potenzial, eine revolutionäre Klasse zu werden, und auf diese Notwendigkeit müssen wir uns stützen. Die Marxisten behandeln die Arbeiterklasse aber nicht wie eine heilige Kuh, wie Trotzki später einmal festhielt:
»Die Massen sind natürlich keineswegs unfehlbar. Idealisierung der Massen liegt uns fern. Wir haben sie unter verschiedenen Bedingungen, in verschiedenen Epochen und außerdem in den schwersten politischen Erschütterungen gesehen. Wir haben ihre starken und schwachen Seiten kennengelernt. Ihre starken Seiten: Entschlossenheit, Opfergeist, Heroismus, haben immer in Zeiten revolutionären Aufschwungs ihren klarsten Ausdruck gefunden. In dieser Periode standen die Bolschewiken an der Spitze der Massen. Danach begann ein anderes Kapitel der Geschichte, das die schwachen Seiten der Unterdrückten an die Oberfläche spülte: Ungleichartigkeit, Mangel an Kultur, ein zu beschränkter Gesichtskreis.« (Trotzki, Ihre Moral und unsere)
Die opportunistische Haltung der Ökonomisten ist der Versuch, lauter zu schreien als es die eigene Stimme erlaubt, und die Suche nach Abkürzungen, wo es keine gibt. So ist es auch nicht verwunderlich, dass sie sich als Vertreter der »reinen Arbeiterbewegung« gaben und von der »organischsten« Verbindung mit den Arbeitern schwärmten. Für Theoretiker hatten sie nur Verachtung übrig, obwohl Marx und Engels die größten Theoretiker waren. Praktisch akzeptierten sie die »Argumente der bürgerlichen ›Nur-Gewerkschaftler‹«, wie Lenin es ausdrückte. Sie verwarfen die revolutionäre Theorie und das bewusste Element im Kampf und »degradierten so die revolutionäre Bewegung (die Sozialdemokratie) zum Trade-Unionismus.«
Die Bedeutung der Politik
Lenin hielt dieser Hinterherlauferei entgegen, dass »das grundlegende wirtschaftliche Interesse des Proletariats nur durch eine politische Revolution befriedigt werden kann, die die Diktatur der Bourgeoisie durch die Diktatur des Proletariats ersetzt.« Es brauchte eine revolutionäre Massenpartei, die sich auf die Arbeiterklasse stützt und auf dem Fundament der marxistischen Theorie und ihrer Prinzipien steht.
Während Lenin anerkannte, dass die Agitation zur Enthüllung schlechter Arbeitsbedingungen usw. wichtig ist, betrachtete er diese Dinge trotzdem als »ausschließlich trade-unionistische« Kämpfe. Er betonte im Gegenzug die Notwendigkeit, »nicht nur den Kampf der Arbeiterklasse für günstige Bedingungen des Verkaufs ihrer Arbeitskraft [zu leiten], sondern auch den Kampf für die Aufhebung der Gesellschaftsordnung, die die Besitzlosen zwingt, sich an die Reichen zu verkaufen. … Daher ist es begreiflich, dass die Sozialdemokraten sich nicht nur nicht auf den ökonomischen Kampf beschränken können, sondern es auch nicht zulassen dürfen, dass die Organisierung der ökonomischen Enthüllungen zu ihrer hauptsächlichen Tätigkeit werde. Wir müssen die politische Erziehung der Arbeiterklasse, die Entwicklung ihres politischen Bewusstseins aktiv in Angriff nehmen.«
Anders ausgedrückt: Es ist notwendig, ausgehend von den unmittelbaren Problemen der Arbeiter, ihre Erfahrungen zu verallgemeinern und sie mit dem breiteren Kampf der Arbeiterklasse für die Veränderung der Gesellschaft zu verbinden. Das bedeutet fähig zu sein, Agitation, Propaganda und Theorie miteinander zu verbinden. Lenin warnte allerdings davor, einfach nur plumpe Agitation zu betreiben, denn einfach nur auf die schlechten Bedingungen der Arbeiter hinzuweisen würde bedeuten, sie wie kleine Kinder zu behandeln. »Aber eine solche Aktivität genügt uns nicht; wir sind keine Kinder, die man mit dem Brei der ›ökonomischen‹ Politik allein abspeisen kann.« – »Es genügt nicht, die politische Unterdrückung der Arbeiter zu erklären.« Man muss alle Ungerechtigkeiten in den verschiedenen Lebensbereichen aufgreifen, um die Entwicklung des Klassenbewusstseins der Arbeiter zu fördern. Indem man die alltäglichen Kämpfe mit einem revolutionären Programm und Theorie verknüpft – also das Allgemeine mit dem Konkreten verbindet –, können die Marxisten das Bewusstsein heben. Das geht nicht, wenn man den Arbeitern einfach nur erzählt, was sie sowieso schon wissen.
Hinter dieser ganzen Auseinandersetzung stand der Konflikt zwischen Marxismus und Opportunismus. Während die Opportunisten den Kampf für Reformen separat vom Kampf für die Revolution betrachteten, betonte Lenin die untrennbare Beziehung zwischen beiden. »Die revolutionäre Sozialdemokratie hat den Kampf für Reformen stets in ihre Tätigkeit eingeschlossen und tut das auch heute.« Aber damit ist die Frage noch nicht erschöpft: »Mit einem Wort, wie der Teil dem Ganzen untergeordnet ist, ordnet sie den Kampf für Reformen dem revolutionären Kampf für Freiheit und Sozialismus unter.« Die Revolutionäre sind für eine Erhöhung der Löhne, aber das ist noch nicht alles. Sie wollen, dass die Arbeiter die Geschicke der Gesellschaft in die Hand nehmen.
Angelehnt an Plechanow beschreibt Lenin den Unterschied zwischen Agitation und Propaganda: »Der Propagandist vermittelt viele Ideen an eine oder mehrere Personen, der Agitator aber vermittelt nur eine oder nur wenige Ideen, dafür aber vermittelt er sie einer ganzen Menge von Personen.« Die Aufgabe des revolutionären Propagandisten ist es, den Arbeitern eine umfassende Erklärung der kapitalistischen Krise zu geben und einen Ausweg aufzuzeigen: »Der Propagandist muss zum Beispiel bei der Behandlung der Frage der Arbeitslosigkeit die kapitalistische Natur der Krisen erklären, die Ursache ihrer Unvermeidlichkeit in der modernen Gesellschaft aufzeigen, die Notwendigkeit der Umwandlung dieser Gesellschaft in eine sozialistische darlegen usw.«
Lenin wies auf die Schwächen der russischen Partei hin. Anhand der Zirkel kritisierte er das niedrige politische Niveau.
»Man nehme einen sozialdemokratischen Zirkel von dem Typus, wie er in den letzten Jahren am meisten verbreitet war, und betrachte seine Arbeit. Er hat ›Verbindungen mit Arbeitern‹ und gibt sich damit zufrieden, er gibt Flugblätter heraus, in denen die Missstände in den Fabriken, die Begünstigung der Kapitalisten durch die Regierung und die Gewalttaten der Polizei gegeißelt werden; gewöhnlich geht in den Versammlungen die Unterhaltung mit den Arbeitern nie oder fast nie über den Rahmen der gleichen Themen hinaus; Referate und Aussprachen über die Geschichte der revolutionären Bewegung, über die Innen- und Außenpolitik unserer Regierung, über Fragen der wirtschaftlichen Entwicklung Russlands und Europas und über die Stellung der verschiedenen Klassen in der modernen Gesellschaft usw. sind eine überaus große Seltenheit. … Im Grunde genommen schwebt den Mitgliedern eines solchen Zirkels in den meisten Fällen als Ideal eines Funktionärs viel eher so etwas wie der Sekretär einer Trade-Union vor als der sozialistische politische Führer. Denn der Sekretär einer beliebigen, beispielsweise englischen Trade-Union hilft den Arbeitern stets, den ökonomischen Kampf zu führen, organisiert Fabrikenthüllungen, erläutert die Ungerechtigkeit von Gesetzen und Maßnahmen, die die Streikfreiheit und die Aufstellung von Streikposten (um jedermann zur Kenntnis zu bringen, dass in dem betreffenden Betrieb gestreikt wird) behindern, klärt über die Voreingenommenheit der Schiedsrichter auf, die den bürgerlichen Klassen des Volkes angehören usw. usf. Mit einem Wort, jeder Sekretär einer Trade-Union führt ›den ökonomischen Kampf gegen die Unternehmer und gegen die Regierung‹ und hilft ihn führen. Man kann nicht genug betonen, dass das noch nicht Sozialdemokratismus ist, dass das Ideal eines Sozialdemokraten nicht der Sekretär einer Trade-Union, sondern der Volkstribun sein muss, der es versteht, auf alle Erscheinungen der Willkür und Unterdrückung zu reagieren, wo sie auch auftreten mögen, welche Schicht oder Klasse sie auch betreffen mögen, der es versteht, an allen diesen Erscheinungen das Gesamtbild der Polizeiwillkür und der kapitalistischen Ausbeutung zu zeigen, der es versteht, jede Kleinigkeit zu benutzen, um vor aller Welt seine sozialistischen Überzeugungen und seine demokratischen Forderungen darzulegen, um allen und jedermann die welthistorische Bedeutung des Befreiungskampfes des Proletariats klarzumachen.«
Zuallererst Revolutionäre
Lenin argumentiert natürlich nicht dagegen, dass Revolutionäre in Gewerkschaften arbeiten oder sich um einzelne Probleme kümmern. Er ist sehr wohl für eine solche Arbeit. Aber er zeigt die Grenzen und Gefahren dieser Herangehensweise auf, wenn sie einseitig behandelt wird. Für Lenin müssen die Sozialdemokraten zuallererst Revolutionäre und erst in zweiter Linie Gewerkschaftler sein, wenn sie in diesem Umfeld arbeiten. Sie mussten Arbeiterkader werden. Die Partei steht in der Pflicht, ihre Mitglieder vor den Gefahren des Opportunismus zu schützen, indem sie ihr theoretisches Niveau hebt, dafür sorgt, dass sie die Sitzungen der Partei besuchen, und sicherstellt, dass sie unter der Anleitung der Partei arbeiten. Lenin sah das als Bedingung, um Parteimitglied zu sein. Diese Kontrolle wird noch wichtiger, wenn Parteimitglieder Posten in der Arbeiterbewegung annehmen, denn dabei besteht die Gefahr, dass man aufgesogen wird und sich in einen einfachen Gewerkschaftssekretär verwandelt. Davor hat Lenin gewarnt.
Er stellte klar, dass »jede Degradierung der sozialdemokratischen Politik zur trade-unionistischen Politik eben bedeutet, den Boden für die Verwandlung der Arbeiterbewegung in ein Werkzeug der bürgerlichen Demokratie vorzubereiten.« Das spiegelt den enormen Anpassungsdruck innerhalb der Arbeiterbewegung wider. Anstatt dass die Revolutionäre ihre Umgebung verändern, verändert die Umgebung sie.
Über das ganze Buch hinweg, das im Wesentlichen eine Polemik gegen die Spontaneität und die Anbiederung an die (bürgerliche) Gewerkschaftspolitik ist, spricht sich Lenin für den Aufbau einer revolutionären Avantgardepartei aus. Diese soll sich auf Berufsrevolutionäre stützen, die bereit sind, ihre ganze Zeit und Mühe in den Dienst der revolutionären Arbeit zu stellen.
»Die Organisation der Revolutionäre dagegen muss vor allem und hauptsächlich Leute erfassen, deren Beruf die revolutionäre Tätigkeit ist (darum spreche ich auch von der Organisation der Revolutionäre, wobei ich die revolutionären Sozialdemokraten im Auge habe). Hinter dieses allgemeine Merkmal der Mitglieder einer solchen Organisation muss jeder Unterschied zwischen Arbeitern und Intellektuellen, von den beruflichen Unterschieden der einen wie der anderen ganz zu schweigen, völlig zurücktreten.«
Hier spricht der wahre Lenin. Innerhalb der revolutionären Partei kann es keine Unterschiede zwischen Arbeitern und Studenten geben: Alle sind Genossen und Kommunisten. Alle Vorurteile wurden außen vor gelassen und waren nicht willkommen. Es war keine Klassenfrage, sondern eine politische Frage. Was die Partei anging, wurden Studenten aus dem bürgerlichen Milieu gemeinsam mit ihren Arbeitergenossen in den Ideen des Marxismus geschult. Damit geben sie ihre früheren Klassenvorurteile politisch auf und gehen auf den Standpunkt des Proletariats über. So verhielt es sich beinahe mit der gesamten Führung der bolschewistischen Partei, die sich aus ehemaligen Studenten zusammensetzte.
Im Übrigen ist Lenins Konzept einer Avantgardepartei – von allen seinen Kritikern (von den Reformisten bis zu den Anarchisten) als schrecklich elitär verschrien – nichts weiter als eine Partei, die der Arbeiterklasse eine Führung anbieten kann. Die Aufgabe der Partei besteht nicht darin, den Arbeitern hinterherzulaufen, sondern auf Basis ihrer kollektiven Erfahrung einen wirklichen Weg nach vorne aufzuzeigen. Das ist keine schlechte, sondern eine gute Sache. Tatsächlich ist das die Daseinsberechtigung einer revolutionären Arbeiterpartei.
Interessanterweise erklärt Lenin, dass vor der Gründung der Russischen Sozialdemokratischen Arbeiterpartei die Marxisten »Studentenzirkel« aufgebaut haben, und spricht von der »allgemeinen Begeisterung der studierenden Jugend jener Zeit für den Marxismus.« Laut G. Sinowjew, einem ehemaligen Studenten:
»Es gab eine Zeit (vor allem in der zweiten Hälfte der 1890er Jahre), in der der Begriff ›Student‹ gleichbedeutend mit dem Begriff ›Revolutionär‹ war, denn in dieser Zeit waren die Schüler der höheren Bildungseinrichtungen revolutionär oder radikal eingestellt und unterstützten die revolutionäre Arbeiterbewegung.« (Sinowjew, Geschichte der KPR (Bolschewiki))
Diese studentischen Revolutionäre würden, verfolgt von den zaristischen Behörden, eine Brücke zur unberührten Arbeiterklasse in Russland schlagen. Die wichtigsten Führer der lokalen Bewegung hatten sich bereits in ihrer Studentenzeit »einen Namen gemacht«, erklärte Lenin.
Indem die revolutionäre Bewegung solche Studenten für den Marxismus gewann und sie ausbildete, schuf sie die frischen Kräfte, die die jungen Arbeiter erreichen konnten. Die ganze Erfahrung des Bolschewismus zeigt, dass ernsthafte Studenten, bewaffnet mit dem Marxismus, zu exzellenten Kadern der revolutionären Bewegung werden können.
Lenin, der immer ein großes Interesse an der Jugend hatte, machte sich die Mühe, auf die »studentenfeindlichen« Vorurteile einiger seiner Gegner zu antworten. »Ein Komitee aus Studenten taugt nichts, es ist nicht widerstandsfähig.« – »Sehr richtig«, stimmt Lenin zu. »Aber hieraus muss der Schluss gezogen werden, dass man ein Komitee aus Berufsrevolutionären braucht, einerlei, ob es ein Student oder ein Arbeiter versteht, sich zum Berufsrevolutionär zu entwickeln.« Wiederum ist es Lenin egal, ob die Revolutionäre Studenten oder Arbeiter sind. Er wollte sowohl Studenten- als auch Arbeiterkader ausbilden. Er fügt hinzu:
»Unsere Aufgabe ist es, nicht für die Degradierung des Revolutionärs zum Handwerkler einzutreten, sondern die Handwerkler auf das Niveau von Revolutionären emporzuheben.« Aber, fügt er hinzu, »es ist notwendig, sich durch jahrelange Arbeit zu einem Berufsrevolutionär auszubilden.«
»Darum muss das Augenmerk vornehmlich darauf gerichtet sein, die Arbeiter auf das Niveau von Revolutionären zu heben, keineswegs aber darauf, sich selbst unbedingt auf das Niveau der ›Arbeitermasse‹ hinabzubegeben, wie es die ›Ökonomisten‹ wollen, oder auf das der ›Durchschnittsarbeiter‹, wie es die ›Swoboda‹ wünscht (die sich in dieser Beziehung auf die zweite Stufe der ökonomistischen ›Pädagogik‹ erhebt). Ich bin weit davon entfernt, zu leugnen, dass für die Arbeiter eine populäre Literatur und für die besonders rückständigen Arbeiter eine besonders populäre (allerdings keine seichte) Literatur notwendig ist. Aber mich empört dieses ständige Vermengen von Fragen der Politik und der Organisation mit Pädagogik. Ihr Herren Sachwalter der ›Durchschnittsarbeiter‹ beleidigt ja eigentlich die Arbeiter durch euren Wunsch, euch unbedingt zu bücken, bevor ihr von Arbeiterpolitik oder von Arbeiterorganisation zu reden anfangt. Redet doch von ernsten Dingen in aufrechter Haltung und überlasst die Pädagogik den Pädagogen, nicht den Politikern und Organisatoren!«
Eine Arbeiterzeitung
Nachdem er seine Gegner abserviert hat, schließt Lenin ›Was Tun?‹ ab, indem er die Bedeutung der Arbeiterzeitung untersucht: »Wir könnten in der nächsten Zukunft ein Wochenblatt herausgeben … Diese Zeitung würde zu einem Teil des gewaltigen Blasebalgs werden, der jeden Funken des Klassenkampfes und der Volksempörung zu einem allgemeinen Brand anfacht. Um diese an und für sich noch sehr harmlose und noch sehr kleine, aber regelmäßige und im vollen Sinne des Wortes gemeinsame Sache könnte man eine ständige Armee von erprobten Kämpfern systematisch sammeln und schulen. Auf dem Gerüst dieses gemeinsamen organisatorischen Baus würden aus den Reihen unserer Revolutionäre bald sozialdemokratische Sheljabows, aus den Reihen unserer Arbeiter russische Bebels emporsteigen und hervortreten, die sich an die Spitze der mobilisierten Armee stellen und das ganze Volk zur Abrechnung mit der Schmach und dem Fluche Russlands führen würden. Das ist es, wovon wir träumen müssen!«
All die harte Arbeit machte im Oktober 1917 diesen Traum zu einer Realität. Lenin hatte eine ganze Generation von bolschewistischen Kadern erzogen, die das Gerüst für den Aufbau einer bolschewistischen Massenpartei bildeten. Unter der Führung von Lenin und Trotzki versammelte die Partei die besten Elemente der Arbeiterklasse und der Bauernschaft um sich, um die Macht zu erobern. Die Marxisten von heute müssen diese Erfahrungen studieren, um sich auf den kommenden Oktober vorzubereiten. Das Studium von Lenins ›Was tun?‹ ist ein wesentlicher Teil dieser Vorbereitung.
London, 2018
- Womit beginnen? – W. I. Lenin
- Der junge Lenin – Leo Trotzki
- Massenstreik, Partei und Gewerkschaften – Rosa Luxemburg
- Bolshevism, the Road to Revolution – Alan Woods [Shop]